Digitalisierung und Vernetzung der technischen Infrastrukturen
Die Wasserwirtschaft gehört bislang zu den weniger digitalisierten Infrastruktursystemen, doch der Grad der Digitalisierung und damit auch die Vernetzung der technischen Infrastrukturen nehmen kontinuierlich zu.
Digitale Lösungen werden in der Wasserwirtschaft einerseits für Mess- und Analyseprozesse und andererseits für die Anlagensteuerung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch in der Abwasserentsorgung eingesetzt, wobei der Nutzungsgrad zwischen den im Infrastruktursystem Wasser tätigen Unternehmen stark variiert [1]. Unterschiede mit Blick auf den Digitalisierungsgrad zeigen sich auch nach Wertschöpfungsstufen und Aufgaben: Während die Trinkwasserverteilung und die Abwasserbehandlung in den meisten Unternehmen hochautomatisiert gesteuert wird [2][1], erfolgt die Überwachung der Wasserqualität häufig manuell. Proben werden per Hand entnommen und zeitlich entkoppelt im Labor analysiert [3]. Gleichzeitig werden digitale Lösungen in vielen Unternehmen auch für verbesserte Datenmanagement- und Verwaltungsprozesse sowie Kundendienstleistungen eingesetzt [1]. Angesichts der wachsenden Datenmengen steigt die Anzahl der Wasserversorgungsunternehmen, die cloudbasierte Lösungen einsetzen [4]. Durch das Bestreben nach umfassenderen Analysen und Überwachung der Anlagen steigt die Konvergenz von IT und OT, sprich die Integration von Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) [5][1].
Auch wenn die häufig noch analog erfassten Betriebsdaten zunehmend aggregiert, integriert und archiviert werden und mit der Nationalen Wasserstrategie Ziele zum Aufbau einer integrierten Infrastruktur formuliert wurden, sind die meisten Datenbestände noch stark fragmentiert, lückenhaft und wenig standardisiert [6]. Selbst Daten zu Wasserentnahmen werden nicht überall in Deutschland gleichermaßen erfasst [7]. Daten fehlen deswegen an Granularität (Datengrafik). Dadurch können fortschrittliche Analysemethoden und ein umfassendes datengestütztes Umweltmonitoring für wasserwirtschaftliche und politische Entscheidungen noch nicht systematisch umgesetzt werden [8].
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Datawrapper zu laden.
Systeme zur Überwachung der Wasserqualität in Echtzeit werden für das Monitoring von Oberflächengewässern und Grundwasser [9], aber auch für die Überwachung der Wasserqualität in Trinkwasserverteilnetzen entwickelt. Allerdings ist die Datendichte in manchen Regionen zu gering, um detaillierte Modelle zu erzeugen und Parameter mit hoher Variabilität zu überwachen. Die dezentrale Datenhaltung, das Fehlen von Datenschnittstellen sowie von günstigen und verlässlichen Sensortechnologien mit langen Akkulaufzeiten und weiträumiger Funkübertragung stellen zentrale Hindernisse dar [1]. Perspektivisch könnten Sensoren und Systeme zur Echtzeit-Datenanalyse direkt an der Infrastruktur (z. B. Pumpstationen, Leitungen) an Bedeutung gewinnen, um schnelle Reaktionszeiten zu ermöglichen und die zentralen Systeme zu entlasten. Um Sensoren für verschiedenste Anwendungen über das gesamte Versorgungsgebiet kostengünstig und energieeffizient einzusetzen, könnten sogenannte LoRaWAN-Netze ausgebaut werden. Diese speziellen Funknetze ermöglichen es, Sensorsignale auch durch dicke Betonwände und weiträumig zu übertragen. Vielerorts ist LoRaWAN schon verfügbar oder die Installation ist in Planung [1].
Digitale Lösungen verbessern auch die Fähigkeit, Wasserangebot und -nachfrage in Echtzeit vorherzusagen. Sowohl das Monitoring des Wasserdargebots als auch die Prognosefähigkeit z. B. von Extremwetterereignissen (z. B. Starkregen, Monitoring von Dürre) gewinnen an Präzision [10][11]. Dabei spielen neue Überwachungsmöglichkeiten durch satellitengestützte hochaufgelöste Fernerkundung und fortschrittliche [12] KI eine zentrale Rolle. Sowohl Erdobservationssatelliten als zunehmend auch Forschungsdrohnen sammeln große Mengen an umweltbezogenen Daten [13], die mit Informationen aus Bodensensoren kombiniert werden können [3]. Die großen Datenbestände können dann mithilfe von Künstlicher Intelligenz immer stärker automatisch und in Echtzeit verarbeitet, übertragen und visualisiert werden [3]. Für eine genauere Prognose der Wassernachfrage wären die Zuverlässigkeit, die Echtzeitfähigkeit und die Kosten digitaler Sensoren zu verbessern und die Dichte von Sensornetzen zu erhöhen [1].
Große Erwartungen werden in ein verbessertes Monitoring und die Entscheidungsunterstützung in Echtzeit gesetzt [1]. Adaptive Steuerungssysteme, die zum Ziel haben, Anlagen an variable Wassernachfrage bzw. Abwasseranfall unter Berücksichtigung von Witterungs- und Klimaveränderungen semi-automatisch anzupassen, gewinnen in der Wasserwirtschaft entsprechend an Bedeutung [1]. Perspektivisch könnten einzelne Pumpwerke und Wasseraufbereitungsanlagen mit KI-gestützten Steuerungssystemen versehen werden, um die Effizienz und Anpassungsfähigkeit bei Schwankungen in der Nachfrage oder klimatischen Bedingungen zu erhöhen [14]. In der Abwasserwirtschaft nehmen die integrierte Überwachung und adaptive Echtzeitsteuerung von Kläranlagen und Kanal- und Regenwassernetzen zu [8]. Ziel ist es, vor allem Regenwasserausleitungen und Mischwasserüberläufe aus dem Kanalnetz in die Gewässer zu reduzieren. Bisher wurde die Echtzeitsimulation zur optimalen Bewirtschaftung von Speicherräumen im Kanalnetz vor allem im Rahmen von Forschungsprojekten in einzelnen Städten implementiert, zum Beispiel in Freiburg [15].
Die vorausschauende Wartung der Infrastrukturen wird zunehmend digital unterstützt. An Bedeutung gewinnen die Zustandserfassung von Infrastrukturen mittels Sensoren, die Fernwartung und die Auswertung großer Datenmengen mittels KI. Systeme zur automatischen Erkennung von Geräteausfällen und Leckagen werden zunehmend entwickelt, eingesetzt und erprobt [2]. Virtual- und Augmented-Reality-Tools werden pilothaft zu Schulungs- und Wartungszwecken eingesetzt, z. B. zur Visualisierung unterirdischer Leitungsnetze oder zur Bedienung komplexer Anlagen [16]. In einzelnen Städten werden digitale Abbilder des Trinkwasser- oder des Kanalnetzes entwickelt, um lange unentdeckte Leckagen zu identifizieren [17] oder die Inspektion und Reinigung zu automatisieren [18]. Eine breite Anwendung von Systemen zur vorausschauenden Instandhaltung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur, die sowohl aus historischen Daten als auch aus Echtzeitdaten lernt, scheitert allerdings bislang häufig an unzureichender IT-Infrastruktur, Datenverfügbarkeit sowie mangelnden Kompetenzen und Ressourcen [19].
Für ein umfassendes und integriertes Wassermanagement werden verlässliche Daten zu Wasserentnahmen und -verbräuchen benötigt. Dies gilt sowohl für Wasserentnahmen durch Individuen als auch durch Großverbraucher. Auf Basis dieser Daten könnten beispielsweise Handlungsspielräume in Dürreperioden identifiziert werden. Neue Wege der Informationsbereitstellung könnten Transparenz schaffen und das Verhalten von Verbraucher/innen beeinflussen [20]. Allerdings fehlt es bisher zumindest in bestimmten Sektoren (z. B. Landwirtschaft) und Bundesländern an Daten zur Wasserentnahme [7]. Auch digitale Zwillinge ganzer Städte können helfen, Wasserverbräuche genauer nachzuverfolgen, zu bewerten und anzupassen. Während ein Modellprojekt in Gelsenkirchen den Fokus auf öffentliche Gebäude legt, wo neben Strom- und Wärme- auch Wasserverbrauchsdaten mittels Sensoren erhoben und abgebildet werden, hat die Stadt Bochum ein Gründachkataster angelegt. Damit können beispielsweise eingesparte Abwassermengen abgeschätzt werden. In einem weiteren Projekt werden die Wasserbedarfe von Stadtbäumen in Abhängigkeit von Bewässerung und Witterung abgebildet [21]. Für eine breite Erfassung von Wasserverbräuchen sind digitale Wasserzähler notwendig, die eine zeitlich hochaufgelöste Ermittlung des Wasserverbrauchs aller Endverbraucher ermöglichen. Da die Integration wasserwirtschaftlicher Daten eine Hürde darstellt [8], sind außerdem eine einheitliche Systematik und die Bereitstellung der Daten über eine zentrale Plattform erforderlich. Für eine darauf aufbauende Steuerung wäre der rechtliche Rahmen (spezifische Nutzungspriorisierungen für die Wasserentnahme in Trockenzeiten) weiterzuentwickeln [22].
- TAB (2023): Chancen und Risiken der Digitalisierung kritischer kommunaler Infrastrukturen an den Beispielen der Wasser- und Abfallwirtschaft. Endbericht zum TA-Projekt. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), DOI: 10.5445/IR/1000163177
- Daniel, I. et al. (2023): A survey of water utilities’ digital transformation: drivers, impacts, and enabling technologies. In: npj Clean Water 6(1), S. 1–9, DOI: 10.1038/s41545-023-00265-7
- Michalak, A. M. et al. (2023): The frontiers of water and sanitation. In: Nature Water 1(1), S. 10–18, DOI: 10.1038/s44221-022-00020-1
- Hein, A.; Lévai, P. (2023): Wo steht die Wasserversorgung bei der Cloud-Nutzung? Erste Erkenntnisse einer Blitzumfrage unter deutschen Wasserversorgern. www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- Pirsing, A. et al. (2024): Picture of the Future für die digitalisierte Wasserwirtschaft im Jahr 2035. www.innovationsatlas-wasser.de/ (17.1.2025)
- LAWA (2024): Fokus Wasser – Folgen des Klimawandels und Maßnahmen zur Anpassung. Beispiele und Lösungsansätze für Wechselwirkungen zwischen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur und Binnenfischerei. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Berlin
- WBGU (2024): Wasser in einer aufgeheizten Welt. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Berlin
- EPRS (2024): Closing the blue loops: responsible and sustainable innovation in the fields of water and ocean. European Parliamentary Research Service, Luxemburg
- Kramer, A. (2022): Managing the invisible – Trends in sustainable groundwater development. Trend Observatory on Water, Bern
- GAO (2023): Artificial Intelligence in Natural Hazard Modeling: Severe Storms, Hurricanes, Floods, and Wildfires. Government Accountability Office, 14.12.2023, www.gao.gov/ (20.12.2024)
- Thapa, K. K. et al. (2024): Attention-Based Models for Snow-Water Equivalent Prediction. In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38(21), S. 22969–22975, DOI: 10.1609/aaai.v38i21.30337
- Nature Water Editorial (2023): Measuring water from space. In: Nature Water 1(2), S. 123–123, DOI: 10.1038/s44221-023-00042-3
- ITA; AIT (2022): Fernerkundung mit KI. Foresight und Technikfolgenabschätzung. Monitoring von Zukunftsthemen für das Österreichische Parlament. Institut für Technikfolgenabschätzung; Austrian Institute of Technology, Wien
- DVGW (2024): Smartes Brunnenbetriebsmanagement. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- Bachmann-Machnik, A. (2020): Optimierung des Betriebs von Kanalnetzen im Mischsystem auf Basis von Online-Messdaten. TU Kaiserslautern, Schriftenreihe Band 7, Kaiserslautern
- de-hub (2025): The digital course of water. de:hub digital ecosystems, www.de-hub.de/ (21.1.2025)
- Jungwirth, J. (2023): Die Kompetenzen der kommunalen Unternehmen nutzen, um nachhaltige Stadtentwicklung zu sichern. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Beschleunigter Wandel und Resilienz, Bonn
- Fraunhofer ENERGIE (2024): Energie / Klima / Umwelt – Wasserinfrastruktursysteme. Fraunhofer-Allianz Energie, 4.10.2024, www.energie.fraunhofer.de/ (4.10.2024)
- DVGW (2024): TRINK-Predict – Entwicklung anwendungsorientierter Predictive Maintenance Ansätze (DVGW Zukunftsprogramm Wasser – W 202406). Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- FORENV (2022): Synthesis Report: Delivering a zero pollution ambition by 2050 – input towards strategic foresight. www.environment.ec.europa.eu/ (14.2.2025)
- Schweitzer, E. et al. (Hg.) (2023): Beschleunigter Wandel und Resilienz: Leitlinien für die Entwicklung resilienter Städte im digitalen Zeitalter (Langfassung): Nationale Dialogplattform Smart Cities. Bonn www.smart-city-dialog.de/
- Flörke, M. et al. (2024): Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit. Anpassung an Tro-ckenheit und Dürre in Deutschland (WAD-Klim). Umweltbundesamt, Texte 143/2024, Dessau-Roßlau
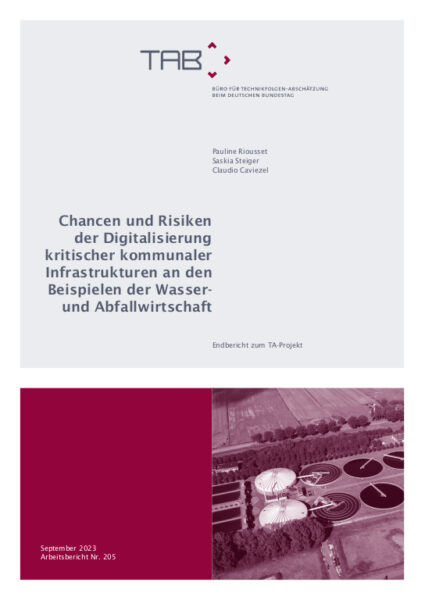
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Wasser (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/wasser
- TAB (2023): Chancen und Risiken der Digitalisierung kritischer kommunaler Infrastrukturen an den Beispielen der Wasser- und Abfallwirtschaft. Endbericht zum TA-Projekt. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), DOI: 10.5445/IR/1000163177
- Daniel, I. et al. (2023): A survey of water utilities’ digital transformation: drivers, impacts, and enabling technologies. In: npj Clean Water 6(1), S. 1–9, DOI: 10.1038/s41545-023-00265-7
- Michalak, A. M. et al. (2023): The frontiers of water and sanitation. In: Nature Water 1(1), S. 10–18, DOI: 10.1038/s44221-022-00020-1
- Hein, A.; Lévai, P. (2023): Wo steht die Wasserversorgung bei der Cloud-Nutzung? Erste Erkenntnisse einer Blitzumfrage unter deutschen Wasserversorgern. www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- Pirsing, A. et al. (2024): Picture of the Future für die digitalisierte Wasserwirtschaft im Jahr 2035. www.innovationsatlas-wasser.de/ (17.1.2025)
- LAWA (2024): Fokus Wasser – Folgen des Klimawandels und Maßnahmen zur Anpassung. Beispiele und Lösungsansätze für Wechselwirkungen zwischen Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur und Binnenfischerei. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, Berlin
- WBGU (2024): Wasser in einer aufgeheizten Welt. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, Berlin
- EPRS (2024): Closing the blue loops: responsible and sustainable innovation in the fields of water and ocean. European Parliamentary Research Service, Luxemburg
- Kramer, A. (2022): Managing the invisible – Trends in sustainable groundwater development. Trend Observatory on Water, Bern
- GAO (2023): Artificial Intelligence in Natural Hazard Modeling: Severe Storms, Hurricanes, Floods, and Wildfires. Government Accountability Office, 14.12.2023, www.gao.gov/ (20.12.2024)
- Thapa, K. K. et al. (2024): Attention-Based Models for Snow-Water Equivalent Prediction. In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 38(21), S. 22969–22975, DOI: 10.1609/aaai.v38i21.30337
- Nature Water Editorial (2023): Measuring water from space. In: Nature Water 1(2), S. 123–123, DOI: 10.1038/s44221-023-00042-3
- ITA; AIT (2022): Fernerkundung mit KI. Foresight und Technikfolgenabschätzung. Monitoring von Zukunftsthemen für das Österreichische Parlament. Institut für Technikfolgenabschätzung; Austrian Institute of Technology, Wien
- DVGW (2024): Smartes Brunnenbetriebsmanagement. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- Bachmann-Machnik, A. (2020): Optimierung des Betriebs von Kanalnetzen im Mischsystem auf Basis von Online-Messdaten. TU Kaiserslautern, Schriftenreihe Band 7, Kaiserslautern
- de-hub (2025): The digital course of water. de:hub digital ecosystems, www.de-hub.de/ (21.1.2025)
- Jungwirth, J. (2023): Die Kompetenzen der kommunalen Unternehmen nutzen, um nachhaltige Stadtentwicklung zu sichern. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Beschleunigter Wandel und Resilienz, Bonn
- Fraunhofer ENERGIE (2024): Energie / Klima / Umwelt - Wasserinfrastruktursysteme. Fraunhofer-Allianz Energie, 4.10.2024, www.energie.fraunhofer.de/ (4.10.2024)
- DVGW (2024): TRINK-Predict - Entwicklung anwendungsorientierter Predictive Maintenance Ansätze (DVGW Zukunftsprogramm Wasser - W 202406). Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., www.dvgw.de/ (17.1.2025)
- FORENV (2022): Synthesis Report: Delivering a zero pollution ambition by 2050 - input towards strategic foresight. www.environment.ec.europa.eu/ (14.2.2025)
- Schweitzer, E. et al. (Hg.) (2023): Beschleunigter Wandel und Resilienz: Leitlinien für die Entwicklung resilienter Städte im digitalen Zeitalter (Langfassung): Nationale Dialogplattform Smart Cities. Bonn www.smart-city-dialog.de/
- Flörke, M. et al. (2024): Auswirkung des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit. Anpassung an Tro-ckenheit und Dürre in Deutschland (WAD-Klim). Umweltbundesamt, Texte 143/2024, Dessau-Roßlau