Neue Bildungsanforderungen und soziale Bildungsungleichheiten
Die Bildungsanforderungen in unserer Gesellschaft steigen kontinuierlich, insbesondere weil der wissenschaftlich-technische Wandel und die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt neue, spezialisierte Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Finanzielle Ressourcen, Bildungsnähe der Eltern und Zugänge zu Fördermöglichkeiten sind oft ungleich verteilt und beeinflussen dadurch Bildungschancen maßgeblich.
Angesichts von gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Veränderungen steht das Bildungssystem vor der Herausforderung, neue Anforderungen an Kompetenzen, Inhalte und Lernformen zu erfüllen. In Deutschland ist, über praktisch alle Branchen weg, eine zunehmende Nachfrage nach Fachkräften festzustellen, die zukünftig mit großer Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen wird [1]. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung führen zu Veränderungen in den Arbeitsinhalten und -prozessen und somit auch zu Veränderungen der geforderten beruflichen Kompetenzen und digitalen Fähigkeiten sowie der sogenannten Soft Skills. Zudem nimmt die Ausdifferenzierung der Arbeitswelt – in anspruchsvollere Tätigkeiten und einfache Routinetätigkeiten – zu [2][3]. Arbeitnehmer/innen sind heute mehr denn je gefordert, ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen auf dem neuesten Stand zu halten und fortlaufend weiterzuentwickeln, wodurch Lebenslanges Lernen sowie berufliche Weiterbildung an Bedeutung gewinnen [4][5]. Zum Nachweis erworbener Qualifikationen und Kompetenzen werden zunehmend digitale Zertifikate eingeführt, die den Stellenwert des Lernens in der Gesellschaft grundlegend verändern können.
Bei der Frage, wie gut das deutsche Bildungssystem auf diese Herausforderungen eingestellt ist, ergibt sich aufgrund gegenläufiger Trends ein widersprüchliches Bild. Zum einen ist in Deutschland seit vielen Jahren ein Trend zur Höherqualifizierung zu beobachten. So werden seit 2015 mehr neue Ausbildungsverträge mit Studienberechtigten als mit Hauptschulabsolventen abgeschlossen [6]. Zum anderen ist seit vielen Jahrzehnten ein Trend zur Akademisierung zu beobachten, der sich zuletzt zwar etwas abgeschwächt zu haben scheint, aber auf hohem Niveau stagniert [7]. Während 1950 auf zehn Studierende noch rund 75 Auszubildende kamen, gab es 2021 mehr als doppelt so viele Studierende (2,9 Millionen) wie Auszubildende (1,3 Millionen) [8]; auffällig ist dabei vor allem der wachsende Anteil der Frauen, die inzwischen mehr als die Hälfte der Erstsemesterstudierenden ausmachen. 2020 begannen erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik mehr junge Menschen ein Hochschulstudium als eine Berufsausbildung [9].
Andererseits zeigen die in regelmäßigem Turnus durchgeführten Schulleistungsuntersuchungen (PISA, IGLU, IQB, TIMSS), dass in Deutschland der Anteil bildungsarmer Schüler/innen in den letzten Jahren zugenommen hat [10][7]. So wurden etwa beim PISA-Test 2022 in sämtlichen Kompetenzbereichen (Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften) im Vergleich zu 2018 deutliche Leistungsabfälle unter den 15-Jährigen festgestellt [10]. Zudem hat der Anteil junger Menschen mit einem sehr niedrigen formalen Bildungsstand zugenommen (Datengrafik). Laut einem aktuellen OECD-Bericht ist Deutschland eines von nur vier OECD-Ländern, in denen der Anteil junger Erwachsener im Alter von 25 bis 34 Jahren ohne Sekundarbereich-II-Abschluss zwischen 2016 und 2023 gestiegen ist [11]. Ebenso hat sich in den letzten Jahren der Anteil der Jugendlichen erhöht, welche die allgemeinbildenden Schulen gänzlich ohne Abschluss verlassen und damit bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt mit besonders großen Problemen konfrontiert sind (2013: 5,7%; 2023: 6,9%) [7]. Zwar steigt die Zahl der Ausbildungsverträge seit einigen Jahren wieder kontinuierlich an, dennoch konnten 2023 35 % aller Ausbildungsplätze nicht besetzt werden (2010: 15%), meist aufgrund eines Mangels an geeigneten Bewerbungen [12].
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Datawrapper zu laden.
Die deutsche Schülerschaft ist zunehmend heterogen, was sich in immer vielfältigeren soziokulturellen Hintergründen widerspiegelt. Hinzu kommt der spezielle Förder- und Nachholbedarf durch die COVID-19-Pandemie, der zusätzliche Anforderungen an die Schulen stellt. Die Leistungen deutscher Schüler/innen sind am Ende der Pflichtschulzeit im OECD-Vergleich besonders breit gestreut [13] und die vorliegenden Daten legen nahe, dass die soziale Herkunft in Deutschland einen großen Einfluss auf den Bildungserfolg hat (Datengrafik): So studieren 56 % der Kinder aus einem akademischen Elternhaus (3% verbleiben ohne Abitur oder Berufsabschluss), hingegen nur 12 % der Kinder formal gering qualifizierter Eltern (40 % verbleiben ohne Abitur oder Berufsabschluss) [14]. Kinder mit Zuwanderungshintergrund, deren Anteil in den Grundschulen seit 2011 um fast 14 Prozentpunkte angestiegen ist (2023: 38%), schneiden in Kompetenztests deutlich schlechter ab als Schüler/innen ohne Zuwanderungsintergrund [15].
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Datawrapper zu laden.
Die Dokumentation und Validierung von im Berufsleben erworbenen Kompetenzen wird angesichts der wachsenden Bedeutung Lebenslangen Lernens immer wichtiger [16]. Papierbasierte Qualifikationsnachweise stoßen angesichts der starken Ausdifferenzierung des Weiterbildungsangebots zunehmend an ihre Grenzen und könnten in Zukunft nach und nach durch digitale Lernzertifikate wie Microcredentials und Open Badges ersetzt werden. Microcredentials ermöglichen den Nachweis von spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten, die in kleineren Bildungskursen erworben wurden [17]. Sie bieten neue Perspektiven für die berufliche Weiterbildung und die Karriereentwicklung, da sie flexibel kombinierbar sind [16]. Microcredentials sind ein zentrales Element des europäischen Bildungsraums, den die Europäische Kommission bis 2025 schaffen will [18]. Die in Form von Microcredentials erworbenen Kenntnisse können durch Open Badges nachgewiesen werden, die als digitale Teilnahmebestätigungen fungieren und die erworbenen Kompetenzen sowie weitere Informationen (z.B. zur ausstellenden Institution) als Metadaten kodieren [19]. Da Open Badges auf einem offenen Standard basieren, können die Nachweise verschiedener Organisationen miteinander verknüpft werden.
Digitale Lernzertifikate wie Microcredentials und Open Badges eröffnen Chancen für eine inklusivere und international anschlussfähigere Anerkennung von Kompetenzen – auch in Bereichen, die bisher im formalen Bildungssystem wenig abgebildet sind – und können so Lebenslanges Lernen fördern und sichtbarer machen. Herausforderungen bestehen in der Entwicklung gemeinsamer Standards für Qualität, Transparenz und grenzübergreifende Vergleichbarkeit sowie in der Schaffung technischer Infrastrukturen für die fälschungssichere Verwaltung digitaler Zertifikate. Die Nationale Bildungsplattform (NBP) entwickelt eine entsprechende Online-Infrastruktur [16]. Distributed-Ledger-Technologien (DLT) können aufgrund ihrer Dezentralität und Integrität einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung und Verbreitung digitaler Lernzertifikate wie Microcredentials oder Open Badges leisten, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Transparenz sowie Interoperabilität [20].
-
Nationale Akademie der Wissenschaften; Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften (2024): Die Zukunft der Arbeit. Stellungnahme. Berlin
-
Arnold, D. et al. (2017): Arbeiten 4.0 – Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. In: Wirtschaftsdienst 97(7), S. 459–476
-
Kutzner, E. et al. (2023): Digitalisierung der Arbeit und Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis. Allgemeine Entwicklungsmuster am Beispiel der Büroarbeit – eine empirische Untersuchung. Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf
-
Ehlers, U.-D. (2020): Future Skills: Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft. Wiesbaden, DOI: 10.1007/978-3-658-29297-3
-
Schachtner, O.; Hammer, M. (2019): Future Skills. Kompetenzen für das 21. Jahrhundert. Linz
-
BIBB (2021): Datenreport / A5.5.1 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss bei Auszubildenden mit Neuabschluss. Bildung 2030 – Sieben Trends, die die Schule revolutionieren. www.bibb.de/ (30.9.2024)
-
Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024): Bildung in Deutschland 2024: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. Bielefeld, DOI: 10.3278/6001820iw
-
Forschung & Lehre (2023): Die Akademisierung der BRD in Zahlen. 15.6.2023, www.forschung-und-lehre.de/ (30.9.2024)
-
Demografieportal (o. J.): Demografieportal – Fakten – Ausbildungs- und Studienanfänger. www.demografie-portal.de/ (15.7.2024)
-
Anders, F. (2023): PISA 2022 – das sind die zehn wichtigsten Ergebnisse. Das Deutsche Schulportal, 5.12.2023, www.deutsches-schulportal.de/ (10.7.2024)
-
OECD (2024): Education at a Glance 2024. Country note: Deutschland. Paris
-
IAB (2024): IAB-Betriebspanel: Rekordhoch beim Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht 16/2024, DOI: 10.48720/IAB.KB.2416
-
Diedrich, J. et al. (2023): Mathematische Kompetenz in PISA 2022. Von Leistungsunterschieden und ihren Entwicklungen. In: Lewalter, D. et al. (Hg.): PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Münster, S. 53–86
-
Statistisches Bundesamt (2024): Hochschulabschluss hängt stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Statistisches Bundesamt, 20.6.2024, www.destatis.de/ (30.9.2024).
-
Lewalter, D. et al. (2023): PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Zusammenfassung.
-
Buchem, I. (2024): Zukunft der Anerkennung? Micro-Credentials, Open Badges und Data-Wallets. In: weiter bilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 31(1), ), S. 32–36, DOI: 10.3278/WBDIE2401W009
-
Vanderheiden, E. (2024): Individuelle Lernkonten und Microcredentials. EU-Bildungsinitiativen zwischen Vision und Wirklichkeit. In: Erwachsenenbildung 70(1), S. 14–17, DOI: 10.13109/erbi-2024-700105
-
Europäische Kommission (2024): Ein europäischer Ansatz für Microcredentials – European Education Area. 19.12.2024, www.education.ec.europa.eu/ (18.3.2025)
-
Buchem, I. et al. (2019): Kompetenzen sichtbar machen mit Open Badges. Abschlussbericht der HFD Community Working Group Kompetenz-Badges. Arbeitspapier Nr. 48. Hochschulforum Digitalisierung, Berlin
-
TAB (2022): Künstliche Intelligenz und Distributed-Ledger-Technologie in der öffentlichen Verwaltung: Ein Überblick von Chancen und Risiken einschließlich der Darstellung international einschlägiger Praxisbeispiele (Autor/innen: Evers-Wölk, M. et al.). Endbericht zum TA-Projekt „Chancen der digitalen Verwaltung“. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, TAB-Arbeitsbericht 201, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000151158
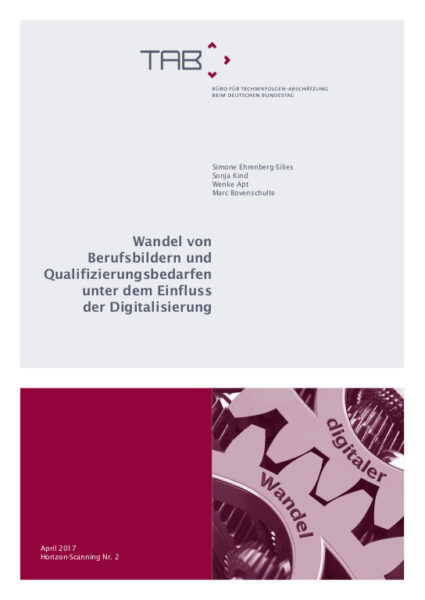
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Bildung und Forschung (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/bildung-und-forschung
-
Nationale Akademie der Wissenschaften; Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften (2024): Die Zukunft der Arbeit. Stellungnahme. Berlin
-
Arnold, D. et al. (2017): Arbeiten 4.0 – Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. In: Wirtschaftsdienst 97(7), S. 459–476
-
Kutzner, E. et al. (2023): Digitalisierung der Arbeit und Auswirkungen auf das Geschlechterverhältnis. Allgemeine Entwicklungsmuster am Beispiel der Büroarbeit – eine empirische Untersuchung. Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf
-
Ehlers, U.-D. (2020): Future Skills: Lernen der Zukunft - Hochschule der Zukunft. Wiesbaden, DOI: 10.1007/978-3-658-29297-3
-
Schachtner, O.; Hammer, M. (2019): Future Skills. Kompetenzen für das 21. Jahrhundert. Linz
-
BIBB (2021): Datenreport / A5.5.1 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss bei Auszubildenden mit Neuabschluss. Bildung 2030 - Sieben Trends, die die Schule revolutionieren. www.bibb.de/ (30.9.2024)
-
Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024): Bildung in Deutschland 2024: Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu beruflicher Bildung. Bielefeld, DOI: 10.3278/6001820iw
-
Forschung & Lehre (2023): Die Akademisierung der BRD in Zahlen. 15.6.2023, www.forschung-und-lehre.de/ (30.9.2024)
-
Demografieportal (o. J.): Demografieportal - Fakten - Ausbildungs- und Studienanfänger. www.demografie-portal.de/ (15.7.2024)
-
Anders, F. (2023): PISA 2022 – das sind die zehn wichtigsten Ergebnisse. Das Deutsche Schulportal, 5.12.2023, www.deutsches-schulportal.de/ (10.7.2024)
-
OECD (2024): Education at a Glance 2024. Country note: Deutschland. Paris
-
IAB (2024): IAB-Betriebspanel: Rekordhoch beim Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht 16/2024, DOI: 10.48720/IAB.KB.2416
-
Diedrich, J. et al. (2023): Mathematische Kompetenz in PISA 2022. Von Leistungsunterschieden und ihren Entwicklungen. In: Lewalter, D. et al. (Hg.): PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Münster, S. 53–86
-
Statistisches Bundesamt (2024): Hochschulabschluss hängt stark vom Bildungsstand der Eltern ab. Statistisches Bundesamt, 20.6.2024, www.destatis.de/ (30.9.2024).
-
Lewalter, D. et al. (2023): PISA 2022. Analyse der Bildungsergebnisse in Deutschland. Zusammenfassung.
-
Buchem, I. (2024): Zukunft der Anerkennung? Micro-Credentials, Open Badges und Data-Wallets. In: weiter bilden. DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung 31(1), ), S. 32–36, DOI: 10.3278/WBDIE2401W009
-
Vanderheiden, E. (2024): Individuelle Lernkonten und Microcredentials. EU-Bildungsinitiativen zwischen Vision und Wirklichkeit. In: Erwachsenenbildung 70(1), S. 14–17, DOI: 10.13109/erbi-2024-700105
-
Europäische Kommission (2024): Ein europäischer Ansatz für Microcredentials - European Education Area. 19.12.2024, www.education.ec.europa.eu/ (18.3.2025)
-
Buchem, I. et al. (2019): Kompetenzen sichtbar machen mit Open Badges. Abschlussbericht der HFD Community Working Group Kompetenz-Badges. Arbeitspapier Nr. 48. Hochschulforum Digitalisierung, Berlin
-
TAB (2022): Künstliche Intelligenz und Distributed-Ledger-Technologie in der öffentlichen Verwaltung: Ein Überblick von Chancen und Risiken einschließlich der Darstellung international einschlägiger Praxisbeispiele (Autor/innen: Evers-Wölk, M. et al.). Endbericht zum TA-Projekt „Chancen der digitalen Verwaltung“. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, TAB-Arbeitsbericht 201, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000151158