Digitalisierung der Forschungswelten
Die wissenschaftliche Praxis hat seit der Corona-Pandemie einen deutlichen Digitalisierungsschub erfahren. Größe und Komplexität von Datensätzen steigen in vielen Forschungsbereichen rasant und ihre Nutzung macht den Ausbau leistungsfähiger Speicher und Rechnerlösungen sowie effizienter Datenmanagementsysteme erforderlich. Zur Analyse der Forschungsdaten werden vermehrt KI-Anwendungen eingesetzt.
Die Digitalisierung schreitet in allen wissenschaftlichen Bereichen mit zunehmender Geschwindigkeit voran [1]. Insbesondere die Corona-Pandemie hat zu einer stärkeren Digitalisierung wissenschaftlicher Praktiken geführt [2] und das kollaborative Arbeiten sowie den Zugang zu Forschungsdaten und -ergebnissen sowie deren Nutzung erleichtert [2]. Bei der Einrichtung europaweiter IKT-Infrastrukturen zur Unterstützung der Forschung in verschiedenen Disziplinen wurden erhebliche Fortschritte erzielt [1]. Außerdem werden kollaborative Plattformen für die Entwicklung und Verbreitung neuer Technologien entwickelt. Dabei handelt es sich um organisatorische Strukturen, die der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und Wissen dienen und in der Regel auf digitalen Anwendungen basieren. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten „Biofoundries“ [3]. Sie bieten eine integrierte Infrastruktur für die rasche Entwicklung, Konstruktion und Erprobung genetisch umprogrammierter Organismen für biotechnologische Anwendungen und Forschungszwecke [4].
Falschinformationen verbreiten sich im Internet schneller denn je. Dies betrifft nicht nur falsche Darstellungen in sozialen Medien, sondern auch wissenschaftliche Ergebnisse, die fragwürdig oder gar falsch sind. Um wissenschaftliche Fehlinformationen oder auch nur einfach inzwischen revidierte Ergebnisse schneller zu identifizieren und ihre Sichtbarkeit zu reduzieren, werden digitale Tools entwickelt. Sie erlauben es Wissenschaftler/innen z.B. schneller zu erkennen, ob ein wissenschaftlicher Artikel von anderen Wissenschaftler/innen besonders stark kritisiert wurde. Andere Tools versenden eine Warnung, wenn eine zitierte Publikation zurückgezogen wurde [5]. Außerdem ermöglichen Fortschritte beim maschinellen Lernen eine immer bessere Erkennung missbräuchlicher Verweise auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder pseudowissenschaftlicher Theorien im Internet [6][7]. Aufgrund mangelnder Zuverlässigkeit und potenzieller Verzerrungen bei der Bewertung von Nachrichten können solche Systeme allerdings nicht eigenständig bzw. ohne menschliche Intervention bei der Inhaltsmoderation eingesetzt werden [8][9]. Zudem setzen die effektivsten Interventionen bei der Bekämpfung von Desinformation die Kooperationen von Plattformbetreibern voraus [10]. Viele von ihnen haben sich jedoch von ihrer Selbstverpflichtung zum Fact-Checking verabschiedet [11].
Größe, Auflösung und Nutzung von Datensätzen nehmen in der Forschung rasant zu [1]. Virtuelle Darstellungen von physischen Objekten, Prozessen und Systemen, die Daten aus der realen Welt verwenden, um Simulationen durchzuführen (von Körperorganen, Teleskopen bis hin zum Planeten Erde), werden zunehmend in wissenschaftlichen Bereichen eingesetzt [1][12]. Zudem werden in vielen Forschungsbereichen digitale Zwillinge von Forschungsinfrastrukturen entwickelt. Die EU-Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, Daten stärker als strategische Ressourcen für Wissenschaft und Politik zu nutzen [13]. In Deutschland wird eine nationale Forschungsdateninfrastruktur aufgebaut, es werden Schulungsangebote für Forschende sowie Standards für den Umgang mit Forschungsdaten entwickelt [14] und Data-Science-Programme an Hochschulen etabliert [15].
Große Datenmengen werden zunehmend mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet [16], vor allem in MINT-Bereichen wie Medizin, Materialwissenschaft, Robotik, Genetik und Informatik [17]. KI dient beispielsweise der beschleunigten Entwicklung neuer Proteine, Medikamente und Materialien [18] (autonome Labore). Generative KI ist dabei von immer größerer Bedeutung [19]. Sie wird für den Entwurf und die automatische Durchführung von Experimenten sowie für die Erkennung von Mustern in großen Datensätzen eingesetzt und kommt als Hilfsmittel bei der Entwicklung wissenschaftlicher Software und bei der Textproduktion zum Einsatz [20]. Auch wissenschaftliche Literaturdatenbanken bieten zunehmend Funktionalitäten an, die es erleichtern, den Stand des wissenschaftlichen Diskurses zu erfassen und aufkommende Forschungsthemen zu identifizieren [21]. Aktuell fehlt es Forschenden allerdings vielfach an ausreichenden Rechenkapazitäten, um Forschung mit KI zu betreiben [22]. Zudem stellt die Dominanz US-amerikanischer Lösungen, die europäischen Datenschutzanforderungen vielfach nicht genügen, ein Hindernis für die Erschließung der Potenziale sowohl für Verwaltungsprozesse als auch für die Forschung selbst dar.
Im Zuge der Digitalisierung haben IT-Sicherheitsvorfälle an Universitäten und Hochschulen in den letzten Jahren zugenommen, sodass der Aufbau von IT-Sicherheitsinfrastrukturen und von Maßnahmen zum Datenschutz immer bedeutender wird. Dazu gehören die Planung und Feststellung von Schutzbedarfen, die Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien und ihre Implementierung sowie Schulungsangebote und Sensibilisierungsmaßnahmen [23]. Ein weiterer Trend geht in Richtung Open Science. Zunehmend werden Datensätze, die von großen Forschungsinfrastrukturen erhoben und bearbeitet werden, auch für Nicht-Expert/innen öffentlich zugänglich gemacht [24]. Der offene Zugang zu Forschungsdaten wird seit einigen Jahren gefördert und hat sich seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie verstärkt. Parallel dazu wird die Möglichkeit erforscht, mit synthetischen Daten zu arbeiten, d.h. mit künstlich generierten Daten, die reale Daten imitieren [25]. Die Anzahl der Nutzer/innen von digitalen Preprint-Sharing-Plattformen, auf denen Forschende ihre Manuskripte vor der formellen Begutachtung und Veröffentlichung teilen können, ist seit Beginn der Pandemie gestiegen [26]. Sie erlauben es Wissenschaftler/innen, schneller Feedback zu erhalten und beschleunigen den wissenschaftlichen Prozess. Die Umsetzung von Open Access – der kostenfreien Bereitstellung von wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsergebnissen – ist in den Bundesländern unterschiedlich weit fortgeschritten [27]. Eine vollständige Transformation hin zu Open Access steht noch aus [28].
Alle diese Trends führen zu einem wachsenden Bedarf an Rechenkapazität und damit auch an Energie, z.B. aufgrund von Simulations- und Modellierungsanforderungen. Parallel dazu schreitet die Europäisierung der E-Forschungsinfrastruktur (Ausbau von Daten- and Rechendiensten, der Höchstleistungsrecheninfrastruktur und des Datenraums) voran. Auch in Deutschland wird die Recheninfrastruktur ausgebaut [29]. Dadurch steigt die Nachfrage nach spezieller Hardware (GPUs, Graphics Processing Units), bei der es jedoch bereits zu Engpässen gekommen ist [30].
Self-Driving Labs (SDL) sind vollständig automatisierte Labore, die KI, maschinelles Lernen und Robotik nutzen, um wissenschaftliche Experimente eigenständig zu planen, durchzuführen und auszuwerten. So können Versuchsreihen extrem beschleunigt werden [31]. Insbesondere für die Entwicklung von Materialien sind SDLs vielversprechend. Forscher/innen in den Chemie-, Material- und Biowissenschaften kombinieren Laborautomatisierung mit künstlicher Intelligenz, um neue Systeme zu schaffen, die alle physikalischen und intellektuellen Schritte der wissenschaftlichen Methode ausführen können [32]. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Knappheit kritischer Rohstoffe könnte dies insbesondere bei der Entwicklung neuer Materialien für die Energiewende besonders relevant werden. Neue Werkstoffe mit neuen Eigenschaften sind die Grundlage vieler aufkommender Technologien. Geeignete Werkstoffe zu finden und herzustellen, ist zeitaufwändig, in Teilen zufallsabhängig und technisch anspruchsvoll. Solche Prozesse zu automatisieren, zu beschleunigen und geeignete Parameterkombinationen mit KI-Techniken zu ermitteln, zu synthetisieren und zu testen, ist das Ziel von ‚AI-assisted self-driving labs‘ (SDL). Die hohen Kosten für präzise Feststoffdosierungs- und Roboterarme, die die erforderliche Präzision, Reproduzierbarkeit, Mobilität und Geschwindigkeit aufweisen, verhindern bislang die breite Anwendung von SDL [33]. Außerdem sind Daten nicht immer verfügbar, es fehlt an geeigneter Software und interoperablen Instrumenten. Daher gibt es bisher erst wenige vollständig automatisierte Labore [31].
Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 wird die Nutzung generativer Künstlicher Intelligenz (gKI) in der Wissenschaft intensiv diskutiert und erprobt. KI-Modelle gelten als Chance und Herausforderung für das Forschungssystem, weil sie nicht nur neue methodische Möglichkeiten eröffnen, sondern auch tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Wissenschaft anstoßen. In vielen Forschungseinrichtungen besteht keine einheitliche Lösung für den Zugang zu gKI-Software. Die meisten Hochschulen improvisieren aktuell noch, z.B. mit Schulungen, in denen auf kostenfreie Angebote hingewiesen wird, wobei die Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit nicht immer gegeben sind. Einzelne Forschungsgesellschaften oder -einrichtungen stellen rechtskonforme ChatBot-Lösungen zur Verfügung, die aus Kooperationen mit kommerziellen Anbietern entstanden sind [34] [35]. Teilweise werden Lizenzen aber auch für einzelne Projekte bzw. Mitarbeiter/innen beschafft. Lösungen über kommerzielle Anbieter schaffen jedoch Abhängigkeiten und verursachen hohe Kosten. Außerdem sind nicht alle Nutzungen datenschutzkonform möglich. Der Zugang zu den besonders teuren und leistungsfähigen Modellen ist aus Kostengründen häufig eingeschränkt. Zunehmend wird aber auch die Möglichkeit diskutiert, nicht-kommerzielle Open-Source-basierte Lösungen für Hochschulen zu entwickeln. Die Sprachmodelle für die Textproduktion müssen nicht notwendigerweise selbst aus deutscher Entwicklung stammen, vielmehr können offene Sprachmodelle internationaler Anbieter in den Forschungseinrichtungen lokal abgelegt und von den Hochschulen selbst nachtrainiert werden. Solche Lösungen erfordern allerdings spezielle technische Kompetenzen und umfangreiche lokale Rechenkapazitäten. Sie sind für die einzelnen Wissenschaftler/innen nicht schnell verfügbar und/oder nicht in der Qualität kommerzieller Lösungen [36]. Für Europa besteht die Chance, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung datenschutzkonformer und transparenter KI-Systeme einzunehmen, die eine Verknüpfung von Datenquellen und deren datenschutzkonforme Analyse ermöglichen.
-
ESFRI (2024): Landscape Analysis 2024. European Strategy Forum on Research Infrastructures, www.landscape2024.esfri.eu/ (12.7.2024)
-
OECD (2023): COVID-19, resilience and the interface between science, policy and society. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 155, Paris, DOI: 10.1787/9ab1fbb7-en
- OECD (2021): Collaborative platforms for emerging technology. Creating convergence spaces. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 109, DOI: 10.1787/ed1e030d-en
-
Hillson, N. et al. (2019): Building a global alliance of biofoundries. In: Nature Communications 10(1), Art. 2040, DOI: 10.1038/s41467-019-10079-2
-
Cabanac, G. (2024): Chain retraction: how to stop bad science propagating through the literature. In: Nature 632(8027), S. 977–979, DOI: 10.1038/d41586-024-02747-1
-
Cavus, N. et al. (2024): Real-time fake news detection in online social networks: FANDC Cloud-based system. In: Scientific Reports 14(1), Art. 25954, DOI: 10.1038/s41598-024-76102-9
-
Rojas, C. et al. (2024): Hierarchical machine learning models can identify stimuli of climate change misinformation on social media. In: Communications Earth & Environment 5(1), Art. 436, DOI: 10.1038/s43247-024-01573-7
-
Boukouvalas, Z.; Shafer, A. (2024): Role of Statistics in Detecting Misinformation: A Review of the State of the Art, Open Issues, and Future Research Directions. In: Annual Review of Statistics and Its Application 11(1), S. 27–50, DOI: 10.1146/annurev-statistics-040622-033806
-
Royal Society (2022): The online information environment. www.royalsociety.org/ (22.1.2025)
-
Bak-Coleman, J. B. et al. (2022): Combining interventions to reduce the spread of viral misinformation. In: Nature Human Behaviour 6(10), S. 1372–1380, DOI: 10.1038/s41562-022-01388-6
-
Car, P. (2025): Fact-checking and content moderation. Epthinktank, 19.2.2025, www.epthinktank.eu/ (21.2.2025)
-
The Economist (2024): Digital twins are enabling scientific innovation. 28.8.2024, www.economist.com/ (30.8.2024)
-
Europäische Kommission (2023b): Work Programme 2023-2024. European Commission Joint Research Centre, Brüssel
-
Universität Konstanz (2024): NFDI – Nationale Forschungsdateninfrastruktur. www.forschungsdaten.info/ (21.6.2024)
-
Bundesregierung (2022): Ein Jahr Datenstrategie. Eine innovative Datenpolitik für Deutschland. 27.1.2022, www.bundesregierung.de/ (19.6.2024)
- Houdeau, D.; Müller-Quade, J. (2023): Datenschatz für KI nutzen, Datenschutz mit KI wahren: Technische und rechtliche Ansätze für eine datenschutzkonforme, gemeinwohlorientierte Datennutzung. Lernende Systeme – Die Plattform für Künstliche Intelligenz, München, DOI: 10.48669/PLS_2023-5
- Royal Society (2024): Science in the Age of AI. How artificial intelligence is changing the nature and method of scientific research. London
-
The Economist (2023): How scientists are using artificial intelligence. 13.9.2023, www.economist.com/ (10.7.2024)
- EFI (2024): Gutachten zu Forschung, Innovation und Technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2024. Expertenkommission Forschung und Innovation, Berlin
-
Albrecht, S. (2024): ChatGPT als doppelte Herausforderung für die Wissenschaft: Eine Reflexion aus der Perspektive der Technikfolgenabschätzung. In: Schreiber, G.; Ohly, L. (Hg.): KI:Text. S. 13–28, Berlin, DOI: 10.1515/9783111351490-003
-
Tyler, C. et al. (2023): AI tools as science policy advisers? The potential and the pitfalls. In: Nature 622(7981), S. 27–30, DOI: 10.1038/d41586-023-02999-3
-
Kudiabor, H. (2024): AI’s computing gap: academics lack access to powerful chips needed for research. In: Nature 636(8041), S. 16–17, DOI: 10.1038/d41586-024-03792-6
-
Hof, H.-J. (2024): Digitalisierung in Hochschulen. In: Fend, L.; Hofmann, J. (Hg.): Digitalisierung in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Wiesbaden, S. 615–635, DOI: 10.1007/978-3-658-43441-0_27
-
OECD (2023): Very Large Infrastructures. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 153, Paris
-
Kompetenzzentrum Öffentliche IT (2023): Synthetische Daten – Künstliche Daten für die digitale Zukunft? www.oeffentliche-it.de/ (16.10.2024)
-
OECD (2023): OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris
-
Open Access Network (2024): Open Access Positionen der Politik. 1.10.2024, www.open-access.network/ (16.10.2024)
- Bärwolff, T. et al. (2023): Open4DE Landscape Report. Open Research Office Berlin, DOI: 10.21428/986c5d43.bab38f02
- BMBF (2024d): Bundesbericht Forschung und Innovation 2024. Forschungs- und innovationspolitische Ziele und Maßnahmen. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
-
EPRS-STOA (2024): What if Europe championed new AI hardware? European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit, At a Glance. What if? Brüssel
-
ITA (2024): Self-Driving Labs (Autor: Fischer, F.). Institut für Technikfolgen-Abschätzung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Monitoring-Bericht für das österreichische Parlament, Wien
- Tobias, A. V.; Wahab, A (2025): Autonomous ‘self-driving’ laboratories: a review of technology and policy implication. In: Royal Society Open Science 12(7), Art. 250646, DOI: 10.1098/rsos.250646
-
Abolhasani, M.; Kumacheva, E. (2023): The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. In: Nature Synthesis 2(6), S. 483–492, DOI: 10.1038/s44160-022-00231-0
-
Fraunhofer-Gesellschaft (2023): FhGenie: Fraunhofer-Gesellschaft nutzt internen KI-Chatbot. www.fraunhofer.de/ (25.3.2025)
-
KIT (2025): Microsoft Copilot. Zentrum für Mediales Lernen. 19.3.2025, www.zml.kit.edu/ (25.3.2025)
-
Salden, P. et al. (2024): Die Bereitstellung generativer KI in Hochschulen. Hochschulforum Digitalisierung, 28.2.2024, www.hochschulforumdigitalisierung.de/ (25.3.2025)
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Bildung und Forschung (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/bildung-und-forschung
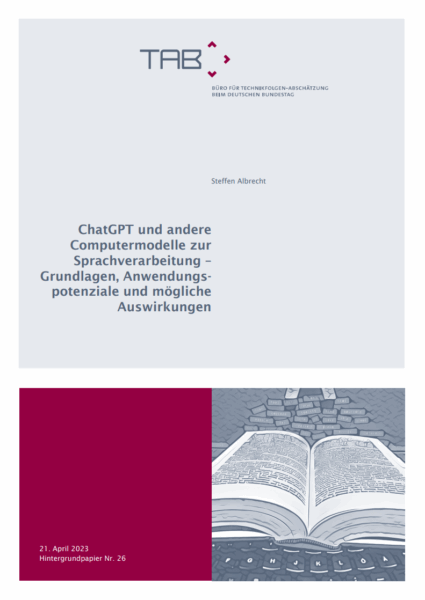
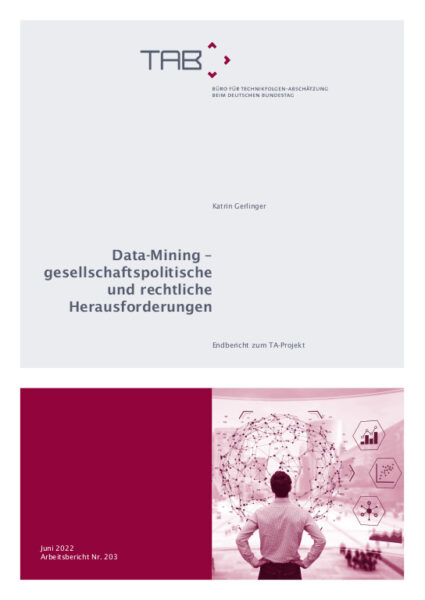
-
ESFRI (2024): Landscape Analysis 2024. European Strategy Forum on Research Infrastructures, www.landscape2024.esfri.eu/ (12.7.2024)
-
OECD (2023): COVID-19, resilience and the interface between science, policy and society. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 155, Paris, DOI: 10.1787/9ab1fbb7-en
- OECD (2021): Collaborative platforms for emerging technology. Creating convergence spaces. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 109, DOI: 10.1787/ed1e030d-en
-
Hillson, N. et al. (2019): Building a global alliance of biofoundries. In: Nature Communications 10(1), Art. 2040, DOI: 10.1038/s41467-019-10079-2
-
Cabanac, G. (2024): Chain retraction: how to stop bad science propagating through the literature. In: Nature 632(8027), S. 977–979, DOI: 10.1038/d41586-024-02747-1
-
Cavus, N. et al. (2024): Real-time fake news detection in online social networks: FANDC Cloud-based system. In: Scientific Reports 14(1), Art. 25954, DOI: 10.1038/s41598-024-76102-9
-
Rojas, C. et al. (2024): Hierarchical machine learning models can identify stimuli of climate change misinformation on social media. In: Communications Earth & Environment 5(1), Art. 436, DOI: 10.1038/s43247-024-01573-7
-
Boukouvalas, Z.; Shafer, A. (2024): Role of Statistics in Detecting Misinformation: A Review of the State of the Art, Open Issues, and Future Research Directions. In: Annual Review of Statistics and Its Application 11(1), S. 27–50, DOI: 10.1146/annurev-statistics-040622-033806
-
Royal Society (2022): The online information environment. www.royalsociety.org/ (22.1.2025)
-
Bak-Coleman, J. B. et al. (2022): Combining interventions to reduce the spread of viral misinformation. In: Nature Human Behaviour 6(10), S. 1372–1380, DOI: 10.1038/s41562-022-01388-6
-
Car, P. (2025): Fact-checking and content moderation. Epthinktank, 19.2.2025, www.epthinktank.eu/ (21.2.2025)
-
The Economist (2024): Digital twins are enabling scientific innovation. 28.8.2024, www.economist.com/ (30.8.2024)
-
Europäische Kommission (2023b): Work Programme 2023-2024. European Commission Joint Research Centre, Brüssel
-
Universität Konstanz (2024): NFDI – Nationale Forschungsdateninfrastruktur. www.forschungsdaten.info/ (21.6.2024)
-
Bundesregierung (2022): Ein Jahr Datenstrategie. Eine innovative Datenpolitik für Deutschland. 27.1.2022, www.bundesregierung.de/ (19.6.2024)
- Houdeau, D.; Müller-Quade, J. (2023): Datenschatz für KI nutzen, Datenschutz mit KI wahren: Technische und rechtliche Ansätze für eine datenschutzkonforme, gemeinwohlorientierte Datennutzung. Lernende Systeme - Die Plattform für Künstliche Intelligenz, München, DOI: 10.48669/PLS_2023-5
- Royal Society (2024): Science in the Age of AI. How artificial intelligence is changing the nature and method of scientific research. London
-
The Economist (2023): How scientists are using artificial intelligence. 13.9.2023, www.economist.com/ (10.7.2024)
- EFI (2024): Gutachten zu Forschung, Innovation und Technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2024. Expertenkommission Forschung und Innovation, Berlin
-
Albrecht, S. (2024): ChatGPT als doppelte Herausforderung für die Wissenschaft: Eine Reflexion aus der Perspektive der Technikfolgenabschätzung. In: Schreiber, G.; Ohly, L. (Hg.): KI:Text. S. 13–28, Berlin, DOI: 10.1515/9783111351490-003
-
Tyler, C. et al. (2023): AI tools as science policy advisers? The potential and the pitfalls. In: Nature 622(7981), S. 27–30, DOI: 10.1038/d41586-023-02999-3
-
Kudiabor, H. (2024): AI’s computing gap: academics lack access to powerful chips needed for research. In: Nature 636(8041), S. 16–17, DOI: 10.1038/d41586-024-03792-6
-
Hof, H.-J. (2024): Digitalisierung in Hochschulen. In: Fend, L.; Hofmann, J. (Hg.): Digitalisierung in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Wiesbaden, S. 615–635, DOI: 10.1007/978-3-658-43441-0_27
-
OECD (2023): Very Large Infrastructures. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers 153, Paris
-
Kompetenzzentrum Öffentliche IT (2023): Synthetische Daten – Künstliche Daten für die digitale Zukunft? www.oeffentliche-it.de/ (16.10.2024)
-
OECD (2023): OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris
-
Open Access Network (2024): Open Access Positionen der Politik. 1.10.2024, www.open-access.network/ (16.10.2024)
- Bärwolff, T. et al. (2023): Open4DE Landscape Report. Open Research Office Berlin, DOI: 10.21428/986c5d43.bab38f02
- BMBF (2024d): Bundesbericht Forschung und Innovation 2024. Forschungs- und innovationspolitische Ziele und Maßnahmen. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
-
EPRS-STOA (2024): What if Europe championed new AI hardware? European Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit, At a Glance. What if? Brüssel
-
ITA (2024): Self-Driving Labs (Autor: Fischer, F.). Institut für Technikfolgen-Abschätzung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Monitoring-Bericht für das österreichische Parlament, Wien
- Tobias, A. V.; Wahab, A (2025): Autonomous ‘self-driving’ laboratories: a review of technology and policy implication. In: Royal Society Open Science 12(7), Art. 250646, DOI: 10.1098/rsos.250646
-
Abolhasani, M.; Kumacheva, E. (2023): The rise of self-driving labs in chemical and materials sciences. In: Nature Synthesis 2(6), S. 483–492, DOI: 10.1038/s44160-022-00231-0
-
Fraunhofer-Gesellschaft (2023): FhGenie: Fraunhofer-Gesellschaft nutzt internen KI-Chatbot. www.fraunhofer.de/ (25.3.2025)
-
KIT (2025): Microsoft Copilot. Zentrum für Mediales Lernen. 19.3.2025, www.zml.kit.edu/ (25.3.2025)
-
Salden, P. et al. (2024): Die Bereitstellung generativer KI in Hochschulen. Hochschulforum Digitalisierung, 28.2.2024, www.hochschulforumdigitalisierung.de/ (25.3.2025)