Gesundheitsbelastungen im Wandel
Durch den demografischen Wandel, ungesunde Lebensgewohnheiten sowie die Folgen von Umweltbelastungen und Klimawandel nehmen die Gesundheitsbelastungen und in Folge die Krankheitslasten zu. Nach wie vor ist das deutsche Gesundheitswesen primär auf die Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und Pflege von Erkrankten ausgerichtet, während Maßnahmen zur Prävention und zum Erhalt von Gesundheit sowie zur Förderung gesunder Lebensweisen bislang nur nachrangig umgesetzt werden.
Chronische Erkrankungen, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-, Atemwegs- oder neurodegenerative Erkrankungen, stellen in Deutschland eine zunehmende Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Mit zunehmendem Alter steigt das individuelle Risiko, chronisch zu erkranken [1], weshalb die kontinuierliche Alterung der Bevölkerung zu einer Zunahme von Krebserkrankungen, Typ-2-Diabetes oder Demenzerkrankungen geführt hat [2][3][4]. Als Auslöser vieler chronischer Erkrankungen gilt zudem insbesondere starkes Übergewicht (Adipositas), dessen Prävalenz in den letzten zwei Jahrzehnten stark zugenommen hat, wobei sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders häufig betroffen sind [5]. Da chronische Erkrankungen nach wie vor nicht vollständig heilbar sind, binden sie in der Summe erhebliche medizinische Ressourcen.
Ein Anstieg ist außerdem bei bestimmten umweltbezogenen Gesundheitsbelastungen zu beobachten, die ebenfalls vor allem ältere oder sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen betreffen [6]. Eine Hauptursache dafür ist der fortschreitende Klimawandel, der mit einer Zunahme von Wetterextremen einhergeht. Seit den Hitzewellen von 2003, 2006, 2013 und 2018 steht aus gesundheitlicher Sicht besonders die Wärmebelastung im Fokus. Steigende Temperaturen sind nach vorliegenden Erkenntnissen für eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen verantwortlich; die Vulnerabilität nimmt vor allem mit höherem Alter zu [7][8]. Das RKI schätzt, dass von 2018 bis 2020 insgesamt etwa 20.000 zusätzliche Todesfälle durch hohe Sommertemperaturen verursacht wurden. Damit wurde erstmalig in drei aufeinanderfolgenden Jahren ein signifikantes Ansteigen hitzebedingter Sterbefälle aufgezeigt [9].
Ein weiterer Trend ist die Zunahme von Zoonosen (von Tier zu Mensch übertragbare Infektionskrankheiten). Jüngste Beispiele sind die durch Coronaviren hervorgerufene weltweite Covid19-Pandemie, der Mpox-Ausbruch in Afrika sowie die Vogelgrippe H5N1 [10][11][12]. Die Häufigkeit von Zoonosen hat in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels weltweit zugenommen, aber auch das Bevölkerungswachstum und der Verlust der Biodiversität beeinflussen die Verbreitung zoonotischer Erreger. In Deutschland ist zudem ein verstärktes Auftreten von vektorübertragenen Infektionskrankheiten festzustellen. So breiten sich hierzulande beispielsweise neue Zeckenarten sowie die Asiatische Tigermücke aus, die Krankheiten wie das Fleckfieber, Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen können [13].
Ein wachsendes Problem stellen zudem antimikrobielle Resistenzen dar, die in der EU derzeit jährlich 35.000 Todesfälle verursachen [14]. Durch den unsachgemäßen und missbräuchlichen Einsatz von Breitbandantibiotika, aber auch durch den Anstieg der Durchschnittstemperaturen [15] gibt es immer mehr Bakterienstämme, die gegen alle bekannten Antibiotika resistent sind. Dazu gehört der multiresistente „Krankenhauskeim“ MRSA ebenso wie die multiresistente Tuberkulose. Verschärft wird die Problematik durch den deutlichen Rückgang der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika sowohl durch öffentliche Einrichtungen als auch durch die Pharmaindustrie seit Ende der 1990er Jahre [16][17]. Zwar gibt es inzwischen entsprechende nationale und internationale Strategien, Aktionspläne und FuE-Programme, aber der Weg bis zur Zulassung und Bereitstellung neuer wirksamer Antibiotika ist lang. Fortschritte bei antimikrobiellen Therapien (z.B. Phagentherapie) wecken derzeit Hoffnungen im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen.
Das deutsche Gesundheitssystem ist nach wie vor primär auf die Diagnose und Behandlung von Krankheiten ausgerichtet, während Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation nur eine untergeordnete Rolle spielen. Seit 2015 sind die Krankenkassen zwar gesetzlich verpflichtet, Präventionsleistungen zu erbringen. Im Jahr 2022 gaben sie jedoch nur einen Bruchteil für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen aus (rund 3,82 Mrd. Euro gegenüber 88,11 Mrd. Euro für Krankenhausbehandlungen und 46,14 Mrd. Euro für ärztliche Behandlungen) [18]. Dennoch sind Bemühungen vonseiten der Politik zu beobachten, die Prävention zu stärken. So wurde 2023 beispielsweise beschlossen, ein neues Bundesinstitut – das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) – aufzubauen, das sich mit der Prävention nichtübertragbarer Erkrankungen befassen soll. Darüber hinaus bieten auch digitale Anwendungen wie Wearables oder Gesundheits-Apps Chancen, die Prävention, Früherkennung und Selbstüberwachung chronischer Erkrankungen zu verbessern (Digital Public Health).
Die wachsenden antimikrobiellen Resistenzen [19] haben in der Humanmedizin das Interesse an alternativen Methoden zur Bekämpfung von Bakterien geweckt. So werden beispielsweise Antivirulenztherapien erforscht, die nicht die Bakterien abtöten, sondern deren Pathogenität hemmen, um Resistenzbildung zu vermeiden. Im Fokus steht zudem die Phagentherapie, bei der bakterielle Infektionen mittels Bakteriophagen therapiert werden. Bei Bakteriophagen handelt es sich um Viren, die Bakterien infizieren und abtöten können. Bei multiresistenten Keimen könnten Bakteriophagen teure und aufwendige Antibiotikaentwicklungen ergänzen oder sogar ersetzen. Da Phagen jedoch häufig nur gegen bestimmte Bakterienarten bzw. -stämme wirksam sind, müssen therapeutische Anwendungen sehr spezifisch auf die Erreger zugeschnitten sein oder, um eine breitere Wirksamkeit zu haben, Mischungen verschiedener Phagen enthalten. Die Phagentherapie ist deshalb kein vollwertiger Ersatz für Antibiotika, sondern kommt vor allem bei chronischen Infektionen infrage. Das Prinzip der Phagentherapie ist schon seit über 100 Jahren bekannt und seine medizinische Anwendung wird in Deutschland in verschiedenen Projekten erforscht [20]. Bislang wurde jedoch noch kein Phagenpräparat in westlichen Industrieländern als Arzneimittel zugelassen. Ein Grund dafür ist, dass in klinischen Studien noch keine ausreichenden Wirksamkeitsnachweise erbracht werden konnten, wie TAB-Bericht aus dem Jahr 2023 zu diesem Thema zeigt [21]. Der TAB-Bericht weist zudem darauf hin, dass einer breiteren Anwendung auch regulatorische und wirtschaftliche Hürden entgegenstehen. So müssten Phagenpräparate, die aus Mischungen unterschiedlicher Phagenarten bestehen und deren Zusammensetzung angepasst werden muss, ggf. neue aufwändige Genehmigungsverfahren durchlaufen. Da Phagenpräparate meist nur für eine kleine Patientengruppe in Frage kommen, ist zudem unklar, ob sich ihre Entwicklung wirtschaftlich amortisieren kann. Zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen ist daher neben neuen Therapieansätzen z.B. auch ein gezielterer Einsatz von Antibiotika erforderlich, um die Resistenzbildung zu verhindern.
Digital Public Health ist ein eher neuer Begriff, der nach der Definition des Fachbereichs Digital Public Health der Deutschen Gesellschaft für Public Health e. V. dieselben Ziele verfolgt wie Public Health, allerdings unter Berücksichtigung digitaler Technologien [22]. Zu den zentralen Aufgaben von Public Health gehören die Krankheitsüberwachung und die Bewertung der Gesundheit der Bevölkerung, die Gesundheitsförderung sowie die Prävention. Die Digitalisierung bietet in diesen Bereichen vielfältige Chancen und hat damit das Potenzial, Public Health und Prävention insgesamt zu stärken und so die wachsenden Kosten des Gesundheitssystems besser in den Griff zu bekommen. So können Gesundheits-Apps und Wearables die Vorsorge und das Selbstmanagement chronischer Krankheiten wie Diabetes unterstützen. Ergänzt werden könnte dies durch KI-gestützte Präventionsplattformen, die auf der Grundlage valider und diskriminierungsfreier Daten individuelle Risikoprofile analysieren und personalisierte Gesundheitsratschläge geben. Ein weiterer Anwendungsbereich ist die digitale Epidemiologie, also Untersuchungen zur Häufigkeit und Verteilung von Krankheit in der Bevölkerung anhand von digitalen Daten [23]. Das Internet, soziale Medien oder mobile Endgeräte bieten einen großen Datenschatz, um Verhaltens-, Interaktions- und Mobilitätsmuster in Bevölkerungsgruppen zu analysieren, was bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten von großem Wert sein kann [24]. Bei der Etablierung datenbasierter Frühwarnsysteme können auch kleinräumige Daten aus Abwasseranalysen einbezogen werden [25]. Das zunehmende Risiko von zoonotischen Erkrankungen oder Antibiotikaresistenzen zeigt die Relevanz von Datenstrukturen, die verschiedene Datenquellen integrieren, um statistische Auffälligkeiten automatisiert erkennen zu können. Digital Public Health ist ein noch junges Forschungsfeld, das in Deutschland erst am Anfang steht. Bei der Implementierung ist darauf zu achten, dass sozioökonomische und gesundheitliche Ungleichheiten nicht verstärkt werden. Ein Problem ist die ungleiche Verteilung in der Bevölkerung hinsichtlich des kompetenten Umgangs mit und des Zugangs zu digitalen Technologien [26]. Gerade Gruppen mit einem erschwerten Zugang zum Gesundheitssystem sind häufig von der Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen ausgeschlossen.
- BMBF (o. J.): Viele Erkrankungen werden mit dem Alter häufig. Bundesministerium für Bildung und Forschung, www.gesundheitsforschung-bmbf.de/ (20.9.2024)
- OECD; European Commission (2025): EU Country Cancer Profile: Germany 2025. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, https://doi.org/10.1787/f3a3cfcf-en
- Deutsche Alzheimer Gesellschaft (2022): Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Informationsblatt 1, Berlin
- Tagesspiegel Background (2024a): Deutliche Zunahme von Typ-2-Diabetes. 2.9.2024, www.background.tagesspiegel.de/ (23.9.2024)
- Schneider, S.; Holzwarth, B. (2022): Sozioökonomische Aspekte der Adipositas. In: Herpertz, S. et al. (Hg.): Handbuch Essstörungen und Adipositas. Berlin, S. 459–465, DOI: 10.1007/978-3-662-63544-5_58
- TAB (2024): Krisenradar – Resilienz von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft durch Krisenvorhersage stärken (Autor/innen: Behrendt, S. et al.). Endbericht zum TA-Projekt. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000171996
- Mehrhof, S.; Bunn, S. (2024): Public health impacts of heat. POSTnote 723, DOI: 10.58248/PN723
- Wong, C. (2024): How climate change is hitting Europe: three graphics reveal health impacts. In: Nature 630(8018), S. 800–801, DOI: 10.1038/d41586-024-02006-3
- Winklmayr, C. et al. (2022): Heat-Related Mortality in Germany From 1992 to 2021. In: Deutsches Ärzteblatt International 119(26), S. 451–457, DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0202
- Jones, K. E. et al. (2008): Global trends in emerging infectious diseases. In: Nature 451(7181), S. 990–993, DOI: 10.1038/nature06536
- Pharma-Fakten (2023): Gesundheitsgefahr Zoonosen: 2,4 Milliarden Erkrankte pro Jahr. 12.12.2023, www.pharma-fakten.de/ (2.7.2024)
- Rivera-Janer, I. (2022): Looking at Possible Anthropogenic Factors Driving the Increase of Zoonotic Disease. Princeton Public Health Review, 5.11.2022, www.pphr.princeton.edu/ (23.9.2024)
- Robert Koch-Institut (2023): Auswirkungen des Klimawandels auf Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen. Teil 1 des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit 2023. In: Journal of Health Monitoring (Special Issue S3), Berlin
- Antunes, L. (2023): Tackling antimicrobial resistance: From science to pharmaceuticals policy. European Parliamentary Research Service, Luxemburg
- Meinen, A. et al. (2023): Antibiotikaresistenz in Deutschland und Europa – Ein systematischer Review zur zunehmenden Bedrohung, beschleunigt durch den Klimawandel. In: Journal of Health Monitoring 8(S3), DOI: 10.25646/11395
- vfa (2020): Arzneimittel – Anzahl der in Deutschland neu eingeführten Antibiotika bis 2020. Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V.; Statista, www.statista.com/ (23.9.2024)
- vfa (2022): Antibiotika: Bestandsaufnahme zu Präparaten und Unternehmen. 1.11.2022, www.vfa.de/ (14.6.2024)
- BMG (2023): GKV – Ausgaben einzelner Leistungsbereiche bis 2022. Statista, www.statista.com/ (23.9.2024)
- Naghavi, M. et al. (2024): Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. In: The Lancet 404(10459), S. 1199–1226, DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01867-1
- Wissenschaftliche Dienste (2024): Projekte zur medizinischen Phagenforschung in Deutschland. Kurzinformation. Deutscher Bundestag, Berlin
- TAB (2023): Bakteriophagen in Medizin, Land- und Lebensmittelwirtschaft – Anwendungsperspektiven, Innovations- und Regulierungsfragen. Innovationsanalyse (Autorren: (Autoren: König, H.; Sauter, A.). Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000160512
- Maaß, L. et al. (2025): Digital Public Health in Deutschland: Status quo, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 68, S. 176–184, DOI: 10.1007/s00103-024-03989-0
- Salathé, M. (2018): Digital epidemiology: what is it, and where is it going? In: Life Sciences, Society and Policy 14(1), S. 1, DOI: 10.1186/s40504-017-0065-7
- Brockmann, D. (2020): Digitale Epidemiologie. In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 63, S. 166–175, DOI: 10.1007/s00103-019-03080-z
- Schmiege, D. et al. (2024): Small-scale wastewater-based epidemiology (WBE) for infectious diseases and antibiotic resistance: A scoping review. In: International Journal of Hygiene and Environmental Health 259, S. 114379, DOI: 10.1016/j.ijheh.2024.114379
- Zeeb, H. et al. (2020): Digital Public Health – ein Überblick. In: Bundesgesundheitsblatt – Gesund-heitsforschung – Gesundheitsschutz 63, S. 137–144, DOI: 10.1007/s00103-019-03078-7
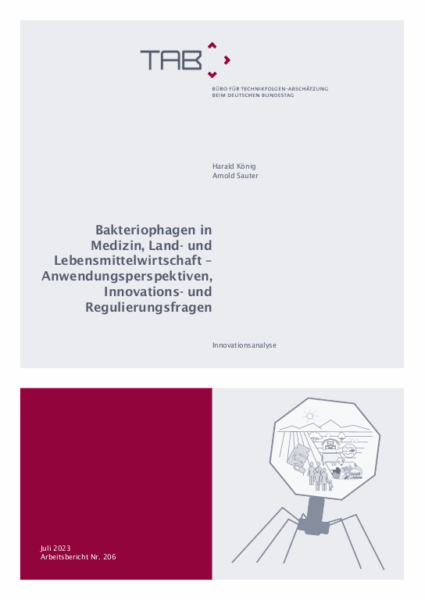
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2024): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Gesundheit (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/gesundheit
- BMBF (o. J.): Viele Erkrankungen werden mit dem Alter häufig. Bundesministerium für Bildung und Forschung, www.gesundheitsforschung-bmbf.de/ (20.9.2024)
- OECD; European Commission (2025): EU Country Cancer Profile: Germany 2025. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, https://doi.org/10.1787/f3a3cfcf-en
- Deutsche Alzheimer Gesellschaft (2022): Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen. Informationsblatt 1, Berlin
- Tagesspiegel Background (2024a): Deutliche Zunahme von Typ-2-Diabetes. 2.9.2024, www.background.tagesspiegel.de/ (23.9.2024)
- Schneider, S.; Holzwarth, B. (2022): Sozioökonomische Aspekte der Adipositas. In: Herpertz, S. et al. (Hg.): Handbuch Essstörungen und Adipositas. Berlin, S. 459–465, DOI: 10.1007/978-3-662-63544-5_58
- TAB (2024): Krisenradar – Resilienz von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft durch Krisenvorhersage stärken (Autor/innen: Behrendt, S. et al.). Endbericht zum TA-Projekt. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000171996
- Mehrhof, S.; Bunn, S. (2024): Public health impacts of heat. POSTnote 723, DOI: 10.58248/PN723
- Wong, C. (2024): How climate change is hitting Europe: three graphics reveal health impacts. In: Nature 630(8018), S. 800–801, DOI: 10.1038/d41586-024-02006-3
- Winklmayr, C. et al. (2022): Heat-Related Mortality in Germany From 1992 to 2021. In: Deutsches Ärzteblatt International 119(26), S. 451–457, DOI: 10.3238/arztebl.m2022.0202
- Jones, K. E. et al. (2008): Global trends in emerging infectious diseases. In: Nature 451(7181), S. 990–993, DOI: 10.1038/nature06536
- Pharma-Fakten (2023): Gesundheitsgefahr Zoonosen: 2,4 Milliarden Erkrankte pro Jahr. 12.12.2023, www.pharma-fakten.de/ (2.7.2024)
- Rivera-Janer, I. (2022): Looking at Possible Anthropogenic Factors Driving the Increase of Zoonotic Disease. Princeton Public Health Review, 5.11.2022, www.pphr.princeton.edu/ (23.9.2024)
- Robert Koch-Institut (2023): Auswirkungen des Klimawandels auf Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen. Teil 1 des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit 2023. In: Journal of Health Monitoring (Special Issue S3), Berlin
- Antunes, L. (2023): Tackling antimicrobial resistance: From science to pharmaceuticals policy. European Parliamentary Research Service, Luxemburg
- Meinen, A. et al. (2023): Antibiotikaresistenz in Deutschland und Europa - Ein systematischer Review zur zunehmenden Bedrohung, beschleunigt durch den Klimawandel. In: Journal of Health Monitoring 8(S3), DOI: 10.25646/11395
- vfa (2020): Arzneimittel - Anzahl der in Deutschland neu eingeführten Antibiotika bis 2020. Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V.; Statista, www.statista.com/ (23.9.2024)
- vfa (2022): Antibiotika: Bestandsaufnahme zu Präparaten und Unternehmen. 1.11.2022, www.vfa.de/ (14.6.2024)
- BMG (2023): GKV - Ausgaben einzelner Leistungsbereiche bis 2022. Statista, www.statista.com/ (23.9.2024)
- Naghavi, M. et al. (2024): Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. In: The Lancet 404(10459), S. 1199–1226, DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01867-1
- Wissenschaftliche Dienste (2024): Projekte zur medizinischen Phagenforschung in Deutschland. Kurzinformation. Deutscher Bundestag, Berlin
- TAB (2023): Bakteriophagen in Medizin, Land- und Lebensmittelwirtschaft – Anwendungsperspektiven, Innovations- und Regulierungsfragen. Innovationsanalyse (Autorren: (Autoren: König, H.; Sauter, A.). Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000160512
- Maaß, L. et al. (2025): Digital Public Health in Deutschland: Status quo, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 68, S. 176–184, DOI: 10.1007/s00103-024-03989-0
- Salathé, M. (2018): Digital epidemiology: what is it, and where is it going? In: Life Sciences, Society and Policy 14(1), S. 1, DOI: 10.1186/s40504-017-0065-7
- Brockmann, D. (2020): Digitale Epidemiologie. In: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 63, S. 166–175, DOI: 10.1007/s00103-019-03080-z
- Schmiege, D. et al. (2024): Small-scale wastewater-based epidemiology (WBE) for infectious diseases and antibiotic resistance: A scoping review. In: International Journal of Hygiene and Environmental Health 259, S. 114379, DOI: 10.1016/j.ijheh.2024.114379
- Zeeb, H. et al. (2020): Digital Public Health – ein Überblick. In: Bundesgesundheitsblatt - Gesund-heitsforschung - Gesundheitsschutz 63, S. 137–144, DOI: 10.1007/s00103-019-03078-7