Neue Bewirtschaftungsformen
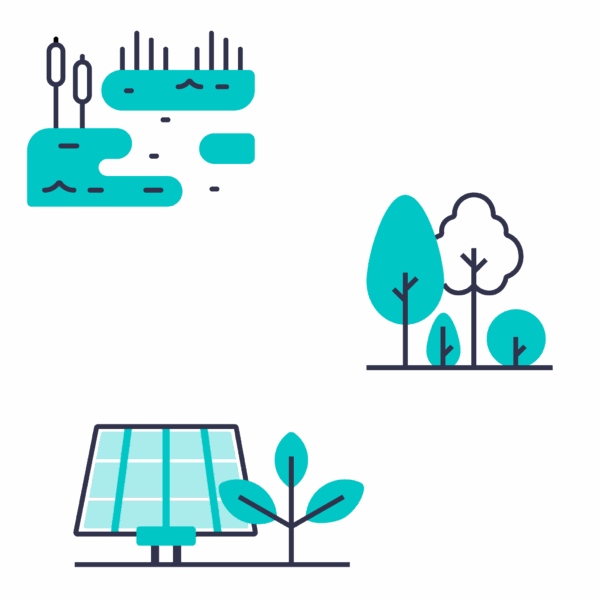
Neue Bewirtschaftungsformen in der Landwirtschaft bieten innovative Ansätze für einen nachhaltigeren Umgang mit Wasserressourcen und die Regeneration landwirtschaftlicher Flächen. Sie zielen insbesondere darauf ab, die Wasserspeicherfähigkeit von Böden zu verbessern, die Verdunstung zu reduzieren und die Wasserverfügbarkeit in der Fläche langfristig zu sichern. Zu den wichtigsten Ansätzen zählen Agroforstsysteme, die Bäume und Sträucher mit landwirtschaftlichen Flächen kombinieren [1]. Sie verbessern die Bodenstruktur, verringern Erosion, wirken als natürliche Wasserpumpen und bieten Windschutz, wodurch Verdunstung reduziert wird und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit und Hitze steigt [2][3]. Agri-Photovoltaikanlagen (Agri-PV) ermöglichen eine Doppelnutzung von Flächen für Landwirtschaft und Energiegewinnung. Durch Verschattung senken sie den Wasserbedarf, schützen den Boden vor Verdunstung und liefern zugleich Energie für effiziente Bewässerungssysteme [4]. Ein weiterer Ansatz ist die Wiedervernässung von Mooren und ihre Nutzung als Paludikultur. Moore speichern große Wassermengen und geben diese langsam wieder ab, was die Wasserversorgung in Trockenperioden unterstützt und Hochwasser abmildert [5][2]. Zudem binden sie Kohlenstoff und fördern die Biodiversität, was die Resilienz des gesamten Ökosystems stärkt. Derzeit sind diese Bewirtschaftungsformen meist noch Nischenanwendungen in der Landwirtschaft, deren breitere Umsetzung mit Unsicherheiten und Hemmnissen verbunden ist.
Im Folgenden werden der Status quo sowie die Potenziale und Entwicklungsdynamiken in diesem strategischen Themenfeld beschrieben.
Status quo
Agroforstsysteme
Traditionelle Agroforstsysteme sind seit Langem weltweit und auch in Mitteleuropa in verschiedenen Ausprägungen verbreitet. Im Zuge der Modernisierung der Landwirtschaft wurde in Europa und Nordamerika jedoch zunehmend auf Gehölze auf Ackerflächen verzichtet, um Platz für Landmaschinen zu schaffen. Die Trennung von Land- und Forstwirtschaft sowie die Abkehr von Streuobstwiesen hin zu Obstplantagen verstärkten diese Entwicklung [6]. Bereits seit 2012 werden Gehölze auf landwirtschaftlichen Flächen in Frankreich angebaut. In der EU sind derzeit etwa 9 % der landwirtschaftlichen Flächen Agroforstsysteme, wobei solche mit Viehhaltung überwiegen [7]. Für Deutschland liegen keine genauen Daten vor. Der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft ermittelte auf der Grundlage freiwillig übermittelter Daten für Ende 2023 eine Fläche von 1.304 ha [8]. Dies sind weniger als 0,01 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Erst seit einigen Jahren und ausgelöst durch die Auswirkungen des Klimawandels zeigt sich in Deutschland wieder ein Trend hin zur stärkeren Nutzung von Agroforstsystemen [6]. Das Thema wird in Deutschland maßgeblich durch die Wissenschaft sowie durch den 2019 gegründeten Deutschen Fachverband für Agroforstwirtschaft (DeFAF) vorangetrieben, in dem Wissenschaftler/innen und Expert/innen verschiedener Fachrichtungen sowie Landwirt/innen und Vertreter/innen aus Kommunen zusammengeschlossen sind.
Mittlerweile wurde die Agroforstwirtschaft weiterentwickelt und an die heutigen landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen angepasst. Die Bewirtschaftung soll dabei möglichst wenig durch Bäume und Gehölze beeinträchtigt werden, sodass eine ökonomisch konkurrenzfähige land- und forstwirtschaftlichen Produktion möglich ist. Das sogenannte „Alley Cropping“ orientiert sich an landwirtschaftlichen Maschinenbreiten. Dabei handelt es sich um Baum- oder Strauchreihen, die in regelmäßigen Abständen angelegt werden, um dazwischen Feldfrüchte oder Futterpflanzen anzubauen. Mit einer an das Gelände angepassten Linienführung in den Feldern (Schlüssellinien werden waagerecht zum Hang/Berg angelegt), dem sogenannten „Keyline-Design“, können Niederschläge besser versickern und damit Trockenheit und Erosion vorgebeugt werden [1]. Die typischen technologischen Entwicklungen in der konventionellen Landwirtschaft, wie autonome Traktoren, sind auf die Bedürfnisse von Monokulturen zugeschnitten und eignen sich nicht für strukturreiche Agroforstsysteme, die durch weniger freien Raum, teils unwegsames Gelände und häufig den Anbau unterschiedlicher Nutzpflanzen gekennzeichnet sind. Laufroboter hingegen, also mobile Maschinen mit beinähnlichen Fortbewegungsmechanismen, die sich auch in unwegsamem Gelände bewegen können, können auch in Agroforstsystemen eingesetzt werden. Durch die Entwicklungen in den Bereichen KI und Reinforcement Learning (RL) haben sich die Navigation und die Fähigkeiten dieser Roboter in den letzten Jahren deutlich verbessert [9][10]. Flexible Kleinroboter können sich auch gut in Mischkulturen bewegen. Die Preise für Laufroboter sind zudem stark gesunken. Auch die Drohnentechnologie zur Pflanzen- und Feldüberwachung entwickelt sich dynamisch [11]. Technologische Entwicklungen im Bereich der KI könnten zukünftig auch die Pflanzenauswahl für Agroforstsysteme prägen. KI-Technologien werden in der Pflanzenzüchtung bisher nur sehr begrenzt eingesetzt. Datenbasierte KI-Anwendungen bergen jedoch enormes züchterisches Potenzial und könnten die Entwicklung widerstandsfähiger und standortangepasster Sorten substanziell voranbringen.
Aufgrund des wachsenden Interesses und der wissenschaftlich nachgewiesenen Vorteile werden Agroforstsysteme in der Agrarpolitik mittlerweile zunehmend als sinnvolle und nachhaltige Landnutzungsform anerkannt und politisch unterstützt. Die Bewirtschaftungsform ist in der ab 2023 geltenden Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) als förderfähig anerkannt. Im Rahmen der Öko-Regelung 3 „Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Acker- und Dauergrünland“ der GAP wurden 2024 bundesweit 173 Hektar Fläche für Agroforstsysteme beantragt (2023 waren es noch 53 Hektar). Die GAP-Planzahlen liegen für das Jahr 2024 bei 7.500 Hektar Fläche. Laut deutschem GAP-Strategieplan von 2021 sollen bis 2026 ca. 200.000 ha Agroforst-Gehölzfläche in Deutschland etabliert werden [12]. Doch der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft erklärte Anfang 2024, dass landwirtschaftliche Betriebe bei der Umstellung auf Agroforstwirtschaft noch immer nicht ausreichend unterstützt werden [13].
Den Vorteilen für die Umwelt stehen ökonomische Nachteile und Risiken gegenüber. Als größter ökonomischer Nachteil gilt der erhöhte Zeit-, Arbeits- und Kapitalbedarf durch die Einführung des Systems und ggf. die Anschaffung neuer Maschinen. Zudem werden hohe Investitionskosten bei der Anlage und Pflege der Agroforstsysteme gesehen. Risiken bestehen zudem dann, wenn es sich um Pachtflächen handelt. Kapitalrückflüsse sind erst nach mehreren Jahren zu erwarten und die Anbauflexibilität ist durch die mehrjährige Flächenbindung eingeschränkt [14].
Agri-PV
Weltweit hat sich die Technologie der Agri-PV in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Agri-PV bietet die Möglichkeit, die Flächeninanspruchnahme zur Umsetzung der Energiewende zu reduzieren und die landwirtschaftliche Fläche zu erhalten. Im Kontext der angestrebten 80 %-Quote erneuerbarer Energien am Strommix bis 2030 gewinnen die Potenziale der Agri-Photovoltaik zunehmend an Bedeutung, was eine verstärkte Förderung erwarten lässt [4][15].
Darüber hinaus eröffnet Agri-PV auch neue Perspektiven im Bereich des Wassermanagements: Die Teilverschattung durch PV-Module kann die Verdunstung auf landwirtschaftlichen Flächen signifikant reduzieren und damit zur effizienteren Nutzung von Wasserressourcen beitragen. In trockenen oder von Wasserknappheit betroffenen Regionen kann dies die Bewässerungsbedarfe senken und die Resilienz der landwirtschaftlichen Produktion gegenüber klimabedingtem Wasserstress erhöhen. Somit kann Agri-PV nicht nur einen Beitrag zur Energiewende und Flächeneffizienz leisten, sondern auch zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser in der Landwirtschaft.
In Deutschland existieren bis dato allerdings erst wenige Agri-PV-Anlagen. Zudem ist Agri-PV im Vergleich zu Agroforstsystemen noch nicht umfassend wissenschaftlich untersucht. Untersuchungsbedarf besteht zur Optimierung der Anlagen (Größe und Abstände), zur Auswahl der Kulturen, zum pflanzenbaulichen Management und auch zu induzierten Mikroklimaveränderungen. Aus technischer Sicht wird weiter an einem gezielten Lichtmanagement unterhalb der Module geforscht, um Pflanzen beispielsweise in wichtigen Wachstumsperioden mehr Licht zur Verfügung zu stellen. Zudem werden Gewächshaussysteme erforscht, bei denen PV-Anlagen in das Gewächshausdach integriert werden.
Die sichere Versorgung mit Solarkomponenten ist gegenwärtig problematisch, weil China mit Marktanteilen von über 80 % alle Wertschöpfungsstufen beherrscht [4]. Das gefährdet auch die weitere Verbreitung von Agri-PV: „Ein Einbruch im Handel mit China würde den PV-Ausbau in Deutschland ernsthaft gefährden und zusätzlich die hiesige Modulproduktion wegen fehlender Vorprodukte stark beeinträchtigen“ [4].
Wiedervernässung von Mooren und Paludikultur
Das Thema Wiedervernässung spielt vor allem vor dem Hintergrund der enormen Kohlenstoff-Speicherpotenziale der Moore eine Rolle und wird zunehmend diskutiert und umgesetzt. Die Wiedervernässung selbst kommt nur langsam voran und wird als sehr komplexe und herausfordernde Aufgabe eingestuft [5]. Landwirtschaft auf wiedervernässten Moorflächen mit Torferhalt, als Paludikultur bezeichnet, führt deshalb derzeit noch ein Nischendasein. Es gibt nur wenige praktische Erfahrungen und es fehlen Anreize sowie Nachfrage für eine Umstellung der landwirtschaftlichen Produktion auf Paludikultur und für die Nutzung von Paludi-Biomasse [16]. Das könnte sich aber mit Blick auf 2050 aufgrund der großen Klimaschutzpotenziale ändern.
Es ist davon auszugehen, dass für die Bewertung, das Monitoring und die Erfolgskontrolle von Wiedervernässungs- und Renaturierungsprojekten vermehrt innovative Methoden der Fernerkundung, der Umwelt-DNA-Biodiversitätsforschung sowie der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden. Die so gewonnenen Daten und Informationen müssen kuratiert, langfristig gesichert und Dritten zur Verfügung gestellt werden. So fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) derzeit 14 Forschungsprojekte im Rahmen des Programms „Methoden der Künstlichen Intelligenz als Instrument der Biodiversitätsforschung“ [5].
In der Landwirtschaft vollzieht sich gegenwärtig ein Paradigmenwechsel: Über Jahrzehnte bis Jahrhunderte stand die gefahrlose Ableitung von Wasser im Vordergrund – hierfür wurden in Moorlandschaften großflächige Meliorationssysteme, also technische Entwässerungs- und Bodenverbesserungsanlagen installiert. Heute muss Melioration neu gedacht werden: Wasserrückhalt bildet die Grundlage einer Bodennutzung, die Degradierung und Torfschwund entgegenwirkt. Paludikulturen eröffnen dabei die Möglichkeit, Moorbodenschutz mit den ökonomischen Interessen von Eigentümer/innen und Nutzer/innen zu verbinden [17].
Die Wiedervernässung ist eine große politische und gesellschaftliche Herausforderung. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die die schnelle Wiedervernässung hemmen oder verhindern. So macht bspw. die geringe Verfügbarkeit von Wasser die Wiedervernässung in einigen Regionen unmöglich. Der Planungsaufwand für die Durchführung einer Wiedervernässung ist relativ hoch und bedarf meist mehrerer Jahre Vorlauf; zuständig für die Genehmigungen sind die Bundesländer. Zudem liegen etwa 90.000 ha Moorböden unter Siedlungsflächen oder Straßen, die abgetragen werden müssten. Schließlich stehen auch konkurrierende landwirtschaftliche und andere Nutzungsinteressen im Raum, die erhebliche Zielkonflikte erzeugen, zumal Eigentümer/innen derzeit nicht verpflichtet sind, Moorböden wiederzuvernässen.
Potenziale und Entwicklungsdynamiken
Derzeit sind diese neuen Bewirtschaftungsformen Nischenanwendungen in der Landwirtschaft. Die Realisierung ihrer Resilienzpotenziale ist daher noch mit Unsicherheiten und Hemmnissen verbunden. Diese betreffen die wirtschaftlichen sowie die damit korrespondierenden ordnungs-, planungs- und förderrechtlichen Rahmenbedingungen. Die Umstellung oder Erweiterung von Betriebszweigen ist für landwirtschaftliche Betriebe mit teilweise hohen ökonomischen Risiken und Planungsunsicherheiten verbunden. Neue Geschäftsmodelle befinden sich noch in der Entwicklungs- und Erprobungsphase.
Wie sich die neuen Bewirtschaftungsformen entwickeln und verbreiten, ist von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängig, v.a. von den regionalen Gegebenheiten sowie von agrarpolitischen und rechtlichen Rahmensetzungen. Hierzu gehören Förderprogramme, eine Anpassung der GAP Öko-Regelungen sowie ein geeigneter Wissenstransfer in die Praxis durch Bildung und Beratung. Einen wichtigen Schub für die Wettbewerbsfähigkeit könnten neue klima- und umweltfreundliche Bewirtschaftungsformen durch eine Internalisierung externer Kosten erhalten. Wenn Mechanismen geschaffen werden, die umweltschädliche Auswirkungen in den Produktpreis mit einbeziehen, könnte das die Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der hier beschriebenen Ansätze deutlich steigern [18].
Ein wachsender Anteil von landwirtschaftlichen Flächen, auf denen Agroforstwirtschaft oder Agri-PV betrieben wird, könnte die künstliche Bewässerung und damit die landwirtschaftliche Wasserentnahme und den Wasserbedarf auf lange Sicht reduzieren [4][19]. Profitieren könnten besonders Regionen, die von einem geringem Wasserdargebot betroffen sind. Darüber hinaus kann der Schutz vor starken Niederschlägen und Hagel erhöht werden. Die breite Anwendung der Paludikultur würde dazu beitragen, die natürliche Wasserregulationsfunktion der Moore zu erhalten: In den Sommermonaten, wenn Pflanzen mehr Wasser benötigen und die Verdunstung steigt, geben nasse Moorböden überschüssiges Wasser an die Umgebung ab. Dadurch kann der erhöhte Wasserbedarf in Dürre- und Trockenphasen teilweise gedeckt und zugleich ein übermäßiges Absinken des Grundwasserspiegels verhindert werden.
Agroforstsysteme
Die Potenziale der Agroforstsysteme in Bezug auf die Kohlenstoffbindung durch den Anbau von Energieholz wurde unter anderem durch die BTU Cottbus ermittelt [20]. Energieholz, also schnellwachsendes Holz, das zur energetischen Verwertung genutzt wird, spielt dabei eine zentrale Rolle, da es CO₂ aus der Atmosphäre bindet und gleichzeitig als klimaneutraler Brennstoff dienen kann. Die Studie kam zu folgendem Ergebnis: Wenn auf 50 % der Ackerfläche in Deutschland Agroforstwirtschaft betrieben würde (davon 10 % für den Anbau von Agroforstgehölzen), könnten jährlich ca. 10 Mio. t CO2-Äqu. in der Holzbiomasse gebunden werden [20]. Das entspricht fast 20 % der THG-Emissionen in der Landwirtschaft aus dem Jahr 2024 [21].
Die durchschnittlichen Effekte von Agroforstsystemen auf das Wassermanagement in der Landwirtschaft sind anhand wissenschaftlicher Untersuchungen und praktischer Anwendung gut belegt. Agroforstsysteme wirken sich positiv auf die Resilienz der Agrarlandschaften gegenüber Wetterextremen aus. Aufgrund der Verschattung und der Reduzierung von Windgeschwindigkeiten wird die Resilienz gegenüber Dürren, Hitze, Erosion und Starkregen gefördert. In Untersuchungen in Brandenburg wurde ermittelt, dass durchschnittlich 28 % weniger potenzielle Bodenverdunstung im Bereich von Ackerkulturen möglich ist [3]. Ein höherer Wasser- und Sedimentrückhalt kann bei dauerhaft begrünten Gehölzreihen erreicht werden. Zudem tragen Agroforstsysteme aufgrund des Wasserrückhalts zu geringeren Boden- und Schadstoffeinträgen in angrenzende Gewässer bei [2].
Agri-PV
Die Verbreitungspotenziale von Agri-PV sind in Studien wissenschaftlich untersucht worden. Das Fraunhofer ISE geht davon aus, dass in Deutschland ein Potenzial von 1.700 GWp (Gigawatt Peak, beschreibt die maximale elektrische Leistung einer Solaranlage unter optimalen Bedingungen) besteht. Demnach würden theoretisch 4 % der deutschen Agrarflächen ausreichen, um mit hoch aufgeständerten Agri-PV-Anlagen den gesamten aktuellen Strombedarf Deutschlands zu decken [4]. Dies entspricht einer Fläche von etwa 29.100 km2. Ein besonders hohes Potenzial von Agri-PV wird in Regionen mit Flächenknappheit und trockenen Böden (aride Klimazonen) gesehen.
Die Kombination von Energieerzeugung und effizientem Wasserverbrauch macht landwirtschaftliche Betriebe widerstandsfähiger gegenüber Wassermangel und extremen Wetterbedingungen. In Bezug auf das Wassermanagement ist die Anordnung der PV-Module entscheidend, damit nicht zu viel Wasser abgeleitet wird, sondern das Auffangen und Speichern von Regenwasser erreicht werden kann. Letzteres führt zur Schonung von Grundwasservorräten bzw. ermöglicht überhaupt erst die landwirtschaftliche Nutzung [4].
Wiedervernässung von Mooren und Paludikultur
Bei der Wiedervernässung von Mooren ist problematisch, dass sie nicht auf einzelnen Flächen, sondern nur für den gesamten Moor- bzw. Grundwasserkörper erfolgen kann. Einzelne Flächen müssten mittels Bodensperren vom Rest abgetrennt werden, was teuer und aufwändig ist. Die Wiedervernässung setzt Wasserverfügbarkeit und ein Wassermanagement vor Ort voraus. Es ist deshalb sinnvoll, in Einzugsgebieten zu denken und zu planen. Mit Blick auf die Etablierung verschiedener Paludikulturen bestehen derzeit noch Hemmnisse aufgrund fehlender Langzeiterfahrungen und der zu langsamen Transformation hin zur Nutzung alternativer Materialien aus Moorpflanzen für Bau- und Dämmstoffe und der entsprechend geringeren Nachfrage nach Paludi-Biomasse. Pflanzen, die sich für Paludikultur eignen, sind bspw. Schilfröhricht und Rohrkolbenröhricht (für Bau- und Dämmstoffprodukte), Großseggenried oder Rohrglanzgraswiese (z. B. für die Herstellung von Faserplatten im Möbelbau). Auch der notwendige Finanzbedarf für die Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzung auf die Paludikultur stellt eine Hürde dar [22][16]. Vorbehalte betroffener Akteure, wie etwa Sorgen über Einbußen materieller Werte, beispielsweise durch sinkende Grundstückswerte oder den Verlust des Ackerstatus (d. h. die rechtliche Einstufung einer Fläche als Ackerland mit entsprechender Nutzungsmöglichkeit), führen bereits heute zu einer ablehnenden Haltung gegenüber Maßnahmen zur Moorwiederherstellung. Laut UBA werden nicht alle wiedervernässten Flächen landwirtschaftlich weiter genutzt werden können. Es ist davon auszugehen, dass auf 80 % der derzeit landwirtschaftlich genutzten Moorflächen eine Umstellung auf Paludikultur möglich wäre [16].
Für Moor-Photovoltaik (Moor-PV) als weitere Integrationsstufe wird in Deutschland ein geschätztes technisches Potenzial von 440 bis 880 GWp angenommen. Dies entspricht ungefähr dem Vier- bis Achtfachen der derzeit in Deutschland installierten Photovoltaik-Leistung und verdeutlicht das enorme Energiepotenzial dieser Nutzung. Die Herausforderungen dieser Nutzungsart liegen unter anderem in der erforderlichen Zusammenarbeit vieler Akteure bei der Entwicklung notwendiger Spezialmaschinen für Installation, Wartung und Rückbau der Moor-PV-Anlagen sowie in der Sicherstellung von ausreichend Licht für standortangepasste und torfschützende Vegetation. Noch gibt es international wie auch in Deutschland nur wenige Pilotprojekte.
- LfL (2024): Agroforstsysteme in Bayern. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, www.lfl.bayern.de (21.01.2025)
- Möckel, S. et al. (2024): Zukunftsfähige Agrarlandschaften in Deutschland – praktische Maßnahmen und ihre Wirksamkeit im Vergleich. In: NuR 46(1), S. 13–24, DOI: 10.1007/s10357-023-4282-y
- Kanzler, M.; Böhm, C. (2020): Agroforstliche Landnutzung als Anpassungsstrategie an den Klimawandel am Beispiel von Untersuchungen zum Verdunstungsschutz in Süd-Brandenburg. Loseblattsammlung Innovationsgruppe AUFWERTEN, Loseblatt # 7
- Fraunhofer ISE (2024): Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende. Ein Leitfaden für Deutschland. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, www.ise.fraunhofer.de (04.07.2025)
- Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (2024): Klima – Wasserhaushalt – Biodiversität: für eine integrierende Nutzung von Mooren und Auen, Halle (Saale)
- Günzel, J.; Pälicke, E. (2022): Agroforst: Das wiederentdeckte Anbausystem. In: Ökologie & Landbau (203), S. 12-14
- Herder, M. et al. (2017): Current extent and stratification of agroforestry in the European Union. In: Agriculture, Ecosystems & Environment 241, S. 121–132, DOI: 10.1016/j.agee.2017.03.005
- DeFAF (2023): Uebersicht zu Agroforstflaechen in Deutschland 2023. Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft, Cottbus, www.agroforst-info.de (31.12.2023)
- Morhart C. et al. (Hg.) (2023): 9. Forum Agroforstsysteme – Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten. Freiburg
- TAB (2021): Digitalisierung der Landwirtschaft: technologischer Stand und Perspektiven. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, Teil I des Endberichts zum TA-Projekt, Arbeitsbericht Nr. 193, Berlin
- Fortune Business Insights (2025): Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Branchentrends für landwirtschaftliche Roboter. www.fortunebusinessinsights.com (21.01.2025)
- BMEL (2024): GAP-Strategieplan. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, www.bmel.de (12.08.2025)
- DeFAF (2024): Agroforstsysteme in der GAP ab 2023 – ein Überblick. Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft, Cottbus, www.agroforst-info.de (Feb 2024)
- Böhm, C.; Hübner, R. (Hg.) (2020): Bäume als Bereicherung für landwirtschaftliche Flächen. Ein Innovationskonzept für die verstärkte Umsetzung der Agroforstwirtschaft in Deutschland. Bayreuth
- Feuerbacher et al. (2022): Estimating the economics and adoption potential of agrivoltaics in Germany using a farm-level bottom-up approach. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, DOI: 10.1016/j.rser.2022.112784
- Schäfer, A. et al. (2022): Anreize für Paludikultur zur Umsetzung der
Klimaschutzziele 2030 und 2050. Umweltbundesamt, Climate Change 44/2022, Dessau-Roßlau, www.umweltbundesamt.de - Närmann, F. et al. (Hg.) (2021): Klimaschonende, biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoorböden. BfN-Skripten 616, Bonn-Bad Godesberg
- Behrendt, S. et. al. (2023): Treiber, Diskurse und Transformationsszenarien. Experimentierfeld Agro-Nordwest, www.agro-nordwest.de (21.11.2023)
- Meinardi, D.; Rötcher, K. (2024): Wassermanagement unter einer Agri-Photovoltaik-Anlage. www.wissenhochn.de (29.04.2024)
- Tsonkova, P.; Böhm, C. (2020): CO2-Bindung durch Agroforst-Gehölze als Beitrag zum Klimaschutz. Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Loseblatt Nr. 6, Cottbus
- UBA (2025b): Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen. Umweltbundesamt, 26.05.2025, https://www.umweltbundesamt.de (30.05.2025)
- Nordt et al. (2022): Leitfaden für die Umsetzung von Paludikultur. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 05/2022, Greifswald
Greifswald, www.greifswaldmoor.de
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Resilienz-Dossier Wassermanagement in der Landwirtschaft (Autor/innen: Behrendt, S.; Bledow, N.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kollosche, I.; Uhl, A.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/wassermanagement-in-der-landwirtschaft/
- LfL (2024): Agroforstsysteme in Bayern. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, www.lfl.bayern.de (21.01.2025)
- Möckel, S. et al. (2024): Zukunftsfähige Agrarlandschaften in Deutschland – praktische Maßnahmen und ihre Wirksamkeit im Vergleich. In: NuR 46(1), S. 13–24, DOI: 10.1007/s10357-023-4282-y
- Kanzler, M.; Böhm, C. (2020): Agroforstliche Landnutzung als Anpassungsstrategie an den Klimawandel am Beispiel von Untersuchungen zum Verdunstungsschutz in Süd-Brandenburg. Loseblattsammlung Innovationsgruppe AUFWERTEN, Loseblatt # 7
- Fraunhofer ISE (2024): Agri-Photovoltaik: Chance für Landwirtschaft und Energiewende. Ein Leitfaden für Deutschland. Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, www.ise.fraunhofer.de (04.07.2025)
- Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (2024): Klima – Wasserhaushalt – Biodiversität: für eine integrierende Nutzung von Mooren und Auen, Halle (Saale)
- Günzel, J.; Pälicke, E. (2022): Agroforst: Das wiederentdeckte Anbausystem. In: Ökologie & Landbau (203), S. 12-14
- Herder, M. et al. (2017): Current extent and stratification of agroforestry in the European Union. In: Agriculture, Ecosystems & Environment 241, S. 121–132, DOI: 10.1016/j.agee.2017.03.005
- DeFAF (2023): Uebersicht zu Agroforstflaechen in Deutschland 2023. Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft, Cottbus, www.agroforst-info.de (31.12.2023)
- Morhart C. et al. (Hg.) (2023): 9. Forum Agroforstsysteme - Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten. Freiburg
- TAB (2021): Digitalisierung der Landwirtschaft: technologischer Stand und Perspektiven. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, Teil I des Endberichts zum TA-Projekt, Arbeitsbericht Nr. 193, Berlin
- Fortune Business Insights (2025): Analyse der Marktgröße, des Marktanteils und der Branchentrends für landwirtschaftliche Roboter. www.fortunebusinessinsights.com (21.01.2025)
- BMEL (2024): GAP-Strategieplan. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, www.bmel.de (12.08.2025)
- DeFAF (2024): Agroforstsysteme in der GAP ab 2023 – ein Überblick. Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft, Cottbus, www.agroforst-info.de (Feb 2024)
- Böhm, C.; Hübner, R. (Hg.) (2020): Bäume als Bereicherung für landwirtschaftliche Flächen. Ein Innovationskonzept für die verstärkte Umsetzung der Agroforstwirtschaft in Deutschland. Bayreuth
- Feuerbacher et al. (2022): Estimating the economics and adoption potential of agrivoltaics in Germany using a farm-level bottom-up approach. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, DOI: 10.1016/j.rser.2022.112784
- Schäfer, A. et al. (2022): Anreize für Paludikultur zur Umsetzung der Klimaschutzziele 2030 und 2050. Umweltbundesamt, Climate Change 44/2022, Dessau-Roßlau, www.umweltbundesamt.de
- Närmann, F. et al. (Hg.) (2021): Klimaschonende, biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoorböden. BfN-Skripten 616, Bonn-Bad Godesberg
- Behrendt, S. et. al. (2023): Treiber, Diskurse und Transformationsszenarien. Experimentierfeld Agro-Nordwest, www.agro-nordwest.de (21.11.2023)
- Meinardi, D.; Rötcher, K. (2024): Wassermanagement unter einer Agri-Photovoltaik-Anlage. www.wissenhochn.de (29.04.2024)
- Tsonkova, P.; Böhm, C. (2020): CO2-Bindung durch Agroforst-Gehölze als Beitrag zum Klimaschutz. Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Loseblatt Nr. 6, Cottbus
- UBA (2025b): Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen. Umweltbundesamt, 26.05.2025, https://www.umweltbundesamt.de (30.05.2025)
- Nordt et al. (2022): Leitfaden für die Umsetzung von Paludikultur. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 05/2022, Greifswald Greifswald, www.greifswaldmoor.de