Geschlossene Produktionssysteme
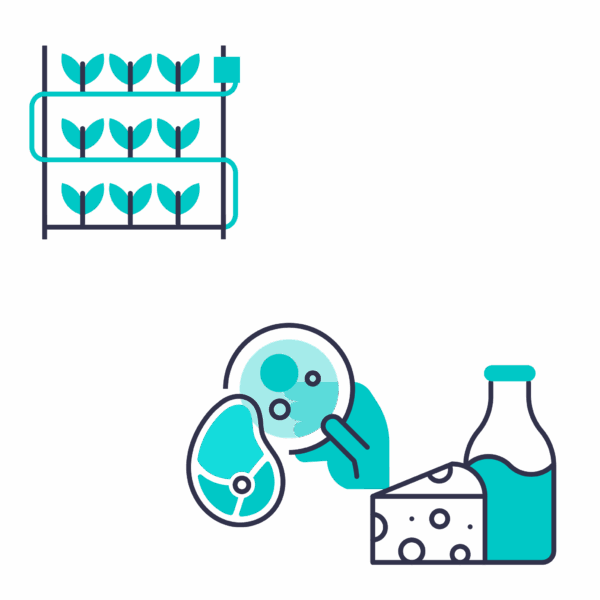
Geschlossene Produktionssysteme in der Landwirtschaft sind hoch kontrollierte, von äußeren Einflüssen abgeschirmte Systeme, die eine besonders wassereffiziente und nachhaltigere Produktion versprechen. Der Verzicht auf Boden verhindert Wasserverluste durch Versickern oder Verdunstung, während Recyclingverfahren den Gesamtwasserbedarf zusätzlich senken [1][2]. In vertikalen Farmen zirkulieren Wasser und Nährstoffe in Kreisläufen, wodurch im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft bis zu 95 % weniger Wasser benötigt wird. Auch kultiviertes Fleisch und Präzisionsfermentation reduzieren den Wasserverbrauch durch gezielte Ressourcennutzung und vermeiden zugleich Einträge in natürliche Kreisläufe. Die automatisierte Steuerung von Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit macht diese Systeme widerstandsfähiger gegenüber Dürreperioden, reduziert den Bedarf an großflächiger Bewässerung und bietet zugleich Schutz vor Wetterextremen wie Hagel oder Starkregen [3][4]. Die Isolierung senkt zudem das Risiko Schädlingsbefall und Krankheiten [5][1]. Ein deutlicher Vorteil ist der geringe Flächenbedarf: geschlossene Systeme ermöglichen saisonunabhängige, urbane bzw. auf begrenzten Flächen betriebene Produktion, entlasten landwirtschaftliche Böden und reduzieren Abhängigkeiten von globalen Lieferketten sowie Transportemissionen [3][4]. Obwohl geschlossene Produktionssysteme derzeit noch Nischenanwendungen sind, besitzen sie großes Potenzial für mehr Resilienz und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Dies gilt insbesondere für den Einsatz in wasserarmen Regionen.
Im Folgenden werden der Status quo sowie die Potenziale und Entwicklungsdynamiken in diesem strategischen Themenfeld beschrieben.
Status quo
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des bestehenden Agrarsystems rücken sogenannte „New Food Systems“ oder „Neue Agrarsysteme ohne Ackerbau und Viehhaltung“ zunehmend in den Fokus von Forschung und Innovationsdebatten. Alternative geschlossene Agrarsysteme umfassen den Anbau von Pflanzen in ackerlosen, geschlossenen Produktionssystemen, auch Indoor oder Vertical Farming genannt, sowie zelluläre Biosysteme (z.B. kultiviertes Fleisch). Die Systeme sind weitgehend unabhängig von Umweltfaktoren wie Saison und Klima. Auf das Wassermanagement wirken sie sich auf unterschiedliche Arten aus: Sie benötigen weniger Wasser und können so die Wassernachfrage der Landwirtschaft senken, außerdem können sie durch weniger Schadstoffeinträge zur Wasserqualität beitragen und die angebauten Pflanzen sind vor Wetterextremen wie Hagel oder Starkregen geschützt. Darüber hinaus können geschlossene Anbausysteme durch freiwerdende Flächen einen indirekten Beitrag zur Stabilisierung des Wasserhaushalts leisten.
Vertical Farming
Beim Vertical Farming werden Pflanzen nicht nur ohne Acker, also ohne Erde, sondern in der Regel auch ohne Sonneneinstrahlung und unter kontrollierten Bedingungen angebaut. Licht wird über (LED-)Beleuchtungssysteme eingebracht, Nährstoffe erhalten die Pflanzen über Nährstofflösungen. Je nach Ansatz wird die Nährstofflösung durch Bewässerung oder durch Nebel zugeführt (Hydroponik bzw. Aeroponik) [1]. Charakteristisch ist zudem die Raumnutzung: Pflanzen werden in Regalsystemen übereinander gestapelt oder in vertikalen Textilsäulen angebaut [2].
Vertical Farming nutzt geschlossene Bewässerungssysteme: Das zugeführte Wasser verlässt das System nicht, sondern zirkuliert darin. Nach einiger Zeit ist es nötig die Nährstofflösung aufzufrischen, wozu dem System neues Wasser zugeführt werden muss; allerdings sind die Zyklen lang und betragen beispielsweise bei der Kultivierung von Tomaten ca. neun bis elf Monate. Die Systeme benötigen viel weniger Wasser als konventionelle Anbaumethoden, da die Temperatur über Klimageräte reguliert wird, Feuchtigkeit durch Rekondensation im Bewässerungszyklus verbleibt und das zur Bewässerung genutzte Wasser nicht ins Grundwasser versickert [1][2]. Durch die Unabhängigkeit von der Saison und die Effizienz der Systeme können in schnellen Zyklen mehrere Ernten über das ganze Jahr erzielt werden [2][3][6].
Wie stark die Effekte auf das Wassermanagement sein können, hängt davon ab, bis zu welchem Grad Vertical Farming herkömmliche Anbaumethoden ersetzen kann. Damit Vertical Farming sich in Deutschland in einem Maßstab etablieren kann, der groß genug ist, um herkömmliche Anbaumethoden wesentlich zu ergänzen, sind Entwicklungen in vier Feldern notwendig: (1) technische Effizienz (v.a. Senkung der Energiebedarfe), (2) eine Erweiterung der Palette von Kulturen, deren Anbau in vertikalen Farmen effizient möglich ist (beispielsweise auch Feldfrüchte), (3) wirtschaftliche Rentabilität (z.B. Energiepreis, Baukosten, aber auch regulatorische Faktoren) und (4) gesellschaftliche Akzeptanz.
Das vollständig geschlossene System mit Nutzung künstlicher Beleuchtungssysteme sowie dem Einsatz von Heizung, Lüftung und Klimatisierung macht einerseits den sehr niedrigen Wasserverbrauch und die sehr hohe Raumeffizienz von Vertical Farming möglich. Andererseits führen diese Elemente auch zu Herausforderungen, vor allem einem hohen Energiebedarf [1]. Ein Ziel der technischen Forschung und Entwicklung ist daher, die Energieeffizienz zu erhöhen.
Ein wesentlicher Teil des Energieverbrauchs ist auf die Beleuchtung zurückzuführen [1][7]. Daher wird an Methoden noch gezielterer Beleuchtung geforscht [2]. Durch Variation des Materials von Regalsystemen kann Beleuchtungsenergie eingespart werden, unter anderem durch reduzierte Abstrahlung oder Teiltransparenz [3]. Alternative Materialien kombiniert mit anderen, dichteren Aufbaustrukturen, können weitere Effizienzgewinne ermöglichen, beispielsweise die Nutzung von vertikalen Textilsäulen [3]. Zudem beschäftigt sich die Forschung mit innovativen, etwa thermochromen Materialien, die sich an Temperaturen anpassen und beispielsweise eine variable Lichtdurchlässigkeit ermöglichen können, wodurch Energiebedarfe für Beleuchtung sowie Heizung und Klimatisierung reduziert werden könnten [3].
Der Frischwasserverbrauch lässt sich durch die Nutzung alternativer Wasserarten weiter senken, etwa durch den Einsatz von Regewassersammelsystemen [3][8]. Es bestehen zudem Synergiepotenziale mit der Abwasserentsorgung: aufbereitetes Abwasser kann für hydroponische Systeme genutzt werden, so können einerseits die Nährstoffe aus dem Abwasser genutzt und andererseits durch Wasserwiederverwendung die Wasserressourceneffizienz erhöht werden [8]. Eine Variante geschlossener Systeme setzt Organismen ein, die in überwiegend salinen Umgebungen gedeihen, wodurch der Bedarf an Süßwasser reduziert werden kann [9]. Darüber hinaus werden innovative Materialien entwickelt, die in der Lage sind, atmosphärische Feuchtigkeit aufzunehmen und diese gezielt für Zwecke der Bewässerung oder Klimatisierung bereitzustellen [3].
Für die weitere Verbreitung von Vertical Farming ist es von großer Bedeutung, welche Kulturen angebaut werden können und wie es gelingt, möglichst effizient möglichst viele Kulturen anzubauen und die Erträge pro Quadratmeter zu erhöhen. Dies ist Gegenstand der Forschung. Anfangs wurden vor allem besonders geeignete, niedrig wachsende Pflanzen mit schnellen Reifezyklen angebaut, z. B. Salate, Microgreens (junge, essbare Keimpflanzen) und Kräuter [1]. Mittlerweile werden in vertikalen Farmen auch Gemüse wie Tomaten, Paprika, Brokkoli produziert sowie „high value crops“ wie medizinische Pflanzen und Beeren [3][10]. In Forschungsprojekten wird auch erfolgreich Weizen angepflanzt – allerdings derzeit mit sehr hohen Energie- und Platzbedarfen [7]. Durch speziell auf Vertical Farming ausgerichtete Züchtung kann es in Zukunft möglich werden, weitere Kulturen anzubauen sowie die Erträge zu erhöhen. Darüber hinaus gibt es Potenziale, den Anbau in vertikalen Farmen durch eine geeignete Gestaltung des wurzelassoziierten Mikrobioms effizienter zu machen [1].
Neben der Vergrößerung der Palette von Kulturen, die sich für Vertical Farming eignen, gibt es auch Synergiepotenziale mit der Zucht anderer Organismen. Aquaponik-Ansätze nutzen die Abfallprodukte aus der Fischzucht zur Nährstoffversorgung von Pflanzen, die ihrerseits das Wasser reinigen, sodass es der Fischzucht wieder zugeführt werden kann [3][11] . Auch die Zucht von Insekten, die im Vergleich mit anderem tierischen Protein weniger Wasser benötigt, kann zusammen mit Aquaponik in einen Vertical-Farming-Kreislauf integriert werden [3]. Die Pflanzenabfälle dienen als Nahrung für die Insekten, die Insektenrückstände können als Fischfutter genutzt werden und die Abfallprodukte aus der Fischzucht können, wie erwähnt, als Nährstoffquelle für die Pflanzen dienen.
Sowohl hohe Betriebs- als auch hohe Investitionskosten hemmen derzeit die Verbreitung von Vertical-Farming-Ansätzen. Die hohen Betriebskosten werden maßgeblich von den Energiepreisen beeinflusst, da der Energieverbrauch, wie beschrieben, hoch ist [3][2][7]. Energieeffizientere Prozesse, eine Integration von erneuerbarer Energieproduktion in das System sowie niedrigere Energiepreise können die Betriebskosten senken. Auch Lohnkosten können erheblich zu den Betriebskosten beitragen. Die Automatisierung bzw. Digitalisierung der Prozesse kann dem entgegenwirken sowie die Effizienz insgesamt steigern, kreiert aber gleichzeitig Bedarfe an Arbeitskräften mit technischem Fachwissen [3]. Die Rentabilität von Vertical Farming hängt auch von den Lebensmittelpreisen ab und wird erschwert, wenn Konkurrenzprodukte, beispielweise durch Subventionen, günstig sind.
Die Investitionskosten von Vertical-Farming-Systemen sind ebenfalls hoch. Neben den Grundstückspreisen, die vor allem in urbanen Räumen sehr teuer sind, fallen sehr hohe Baukosten an, die deutlich höher sein können als die Kosten für Gewächshausanlagen [1][2]. Die Umnutzung bestehender (Industrie-)Gebäude kann diese Kosten reduzieren, allerdings kann es regulatorische Einschränkungen geben [3]. Je nach angebauter Kultur sind die Platzbedarfe und damit die Baukosten unterschiedlich, vor allem für Weizen wären sehr große und sehr hohe Gebäude nötig, was die Investitionskosten besonders in die Höhe treibt [7].
Nachfrageseitig ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Produkten aus Vertical Farming zentral. Es gibt in Deutschland erhebliche gesellschaftliche Skepsis gegenüber ackerlosen Systemen, die teilweise als unnatürlich und ungesund wahrgenommen werden. Der Grad der Informiertheit bei Konsument/innen ist eher gering [1]. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach lokalen Produkten ohne Pestizide gestiegen, für die es teilweise hochpreisige Marktsegmente gibt. Um solche Attribute bei Produkten aus Vertical-Farming-Systemen hervorzuheben, sind Label hilfreich. In manchen Ländern, beispielsweise den Vereinigen Staaten, können Produkte aus Vertical Farming mit Bio-Labeln ausgezeichnet werden. In der EU ist das für den ackerlosen Anbau bislang nicht möglich [1][8]. Auch bei Systemen, die Nährstoffe aus dem Abwasser nutzen, besteht bei Konsument/innen Informationsbedarf; entsprechendes Wissen vorausgesetzt, kann jedoch voraussichtlich ein hohes Produktvertrauen erreicht werden [8].
Die Akzeptanz von Vertical Farming bzw. der dafür nötigen, teilweise sehr großen Gebäude ist unterschiedlich hoch – in (ehemaligen) Industriegebieten ist sie tendenziell höher [8]. Landwirt/innen begegnen dem Konzept des Vertical Farming mit teils skeptischer, teils offener Haltung, letzteres vor allem im Hinblick auf längerfristige Perspektiven. Diese Haltung scheint wesentlich davon abzuhängen, inwieweit Vertical-Farming-Ansätze auch konkrete Chancen für Landwirt/innen eröffnen und wie diese Potenziale kommuniziert werden.
Zelluläre Lebensmittelproduktion
In der Zellulären Lebensmittelproduktion werden durch biotechnologische Verfahren Produkte hergestellt, die in molekularer Hinsicht tierischen Lebensmitteln gleichen. Dabei kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz:
- Die Produktion von zellkulturbasierten Fleischprodukten erfolgt durch Tissue-Engineering-Techniken (Gewebezüchtung) in einer kontrollierten, geschlossenen Umgebung. Muskelzellen werden in einem Nährmedium kultiviert und in einem Bioreaktor zum Wachstum angeregt. Anschließend werden sie auf ein Trägergerüst transferiert, wo eine Muskelfaserstruktur entsteht [4][12].
- Präzisionsfermentation wird unter anderem genutzt, um tierfreie Milchprodukte herzustellen, und spielt z.T. auch in der Herstellung von Fleischersatzprodukten eine Rolle. Bei der Präzisionsfermentation werden Mikroorganismen genetisch so programmiert, dass sie spezifische Proteine synthetisieren. Unter Zugabe von Nährstoffen und Zucker können dann die entsprechenden Proteine, wie z.B. Milchproteine, im Bioreaktor hergestellt werden. Diese werden beispielsweise mit Wasser oder Pflanzenfetten kombiniert, um tierfreie Milchprodukte zu erzeugen [12][13][14].
Im Vergleich zu Vertical Farming befindet sich die Produktion von zellkulturbasierten Fleischprodukten in einem frühen Entwicklungsstadium. Damit sie kommerziell erfolgreich sein und dadurch herkömmliche Nutztierhaltung in relevantem Maße ersetzen kann, bedarf es weiterer Fortschritte in der technischen Entwicklung, der Wirtschaftlichkeit sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Bei der Produktion von kultiviertem Fleisch werden derzeit noch in mehreren Bereichen tierische Bestandteile genutzt, sowohl bei der Gewinnung von Muskelstammzellen als auch bei der Erzeugung von Nährmedien und Trägerstrukturen [5]. Für diese Komponenten, die zugleich auch mit die größten Kosten verursachen, wird intensiv an Alternativen geforscht. Es ist zu erwarten, dass solche Alternativen zukünftig zumindest teilweise verfügbar sein werden [5].
Wie beim Vertical Farming ist auch bei kultiviertem Fleisch der aktuell sehr hohe Energiebedarf ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung und Verbreitung. Vor allem für die Produktion des Nährmediums sowie den Betrieb des Bioreaktors wird derzeit viel Energie benötigt [4]. Weitere Forschung, vor allem hinsichtlich Kühlung und Wärmezufuhr, kann helfen, die Energieeffizienz zu steigern und damit den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten deutlich zu senken [5].
Die Herstellungskosten für kultiviertes Fleisch sind zwar gesunken, liegen aber nach wie vor deutlich über denen vergleichbarer konventioneller Fleischprodukte [15]. Dies ist u.a. auf die hohen Produktionskosten für die benötigten Nähr- und Wachstumsmedien zurückzuführen. Weitere deutliche Kostensenkungen könnten u.a. dadurch erschwert werden, dass die starken Interessen der herkömmlichen Fleischindustrie, die sich teilweise deutlich von denen einer zukünftigen Fleischindustrie zellkulturbasierter Fleischproduktion unterscheiden, Forschung und Entwicklung in diesem Bereich hemmen [4].
Die Investitionskosten für Anlagen für die Produktion von kultiviertem Fleisch sind hoch, etwas günstiger wäre die Umrüstung von existierenden Fermentationsanlagen [12].
Da kultiviertes Fleisch bisher nur in Einzelfällen kommerziell verfügbar ist, lässt sich die Entwicklung von Akzeptanz und Nachfrage derzeit nur schwer einschätzen. Die Akzeptanz wird unter anderem durch eine „Natürlichkeits-Heuristik“ geschwächt, die davon ausgeht, dass die „Unnatürlichkeit“ eines Produkts negativ bewertet wird [5][4]. Weitere Faktoren, die sich negativ auf die Akzeptanz auswirken, sind Skepsis hinsichtlich der Konkurrenzfähigkeit von kultiviertem im Vergleich zu konventionellem Fleisch bezüglich Geschmack und Umweltverträglichkeit sowie Zweifel an der Produktsicherheit [5]. Positiv könnten sich hingegen ethische Aspekte, insbesondere hinsichtlich des Tierwohls, auf Akzeptanz und Nachfrage zellbasierter Fleischprodukte auswirken [16].
Präzisionsfermentation ist in anderen Anwendungsbereichen als der Nahrungsmittelproduktion etabliert, beispielsweise in der Medizin. Als Verfahren zur Herstellung tierfreier Milchprodukte wird sie bisher vor allem im Labor- und Pilotmaßstab erprobt [12][13].
Bei der Präzisionsfermentation entfällt ein Großteil des Ressourcenverbrauchs auf die Produktion von Zucker als Nährmedium. Als alternative und ggf. kostengünstigere Nährmedien kommen unter anderem Abfallprodukte aus der Landwirtschaft oder der Lebensmittelproduktion infrage. Es gibt allerdings noch offene Fragen zum mikrobiellen Stoffwechsel bei der Nutzung dieser alternativen Nährmedien sowie zu Logistik und Kosten [12].
Investitionen in Präzisionsfermentation werden zusätzlich durch Unklarheiten im Regulierungsrahmen der EU erschwert [17]. Falls sich im Endprodukt gentechnisch veränderte Organismen oder ihre Rückstände befinden, fallen Produkte aus Präzisionsfermentation unter den Regulierungsrahmen für gentechnisch veränderte Lebensmittel, ansonsten unter die Novel-Food-Verordnung (EU) 2015/2283. Beide Zulassungsverfahren sind mit hohen regulatorischen Anforderungen verbunden. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig, frühzeitig den zutreffenden Rechtsrahmen zu kennen, was bei Unklarheiten beim Klassifizierungsprozess schwierig sein kann [17].
Hinsichtlich zunehmender Akzeptanz und wachsender Nachfrage bestehen bei Milchprodukten aus Präzisionsfermentation tendenziell größere Chancen als bei kultiviertem Fleisch. Eine Studie mit potenziellen Frühadoptierer/innen deutet auf verhaltene Offenheit hin, wobei Geschmack und genetische Veränderungen kritisch betrachtet werden [12][13]. Positiv auf die Akzeptanz könnten sich die Möglichkeit, laktose- und antibiotikafreie Produkte anzubieten sowie den Nährstoffgehalts präzise anpassen zu können, auswirken [14].
Potenziale und Entwicklungsdynamiken
Die konkreten Resilienzpotenziale von geschlossenen Systemen hinsichtlich der Auswirkungen auf das Wassermanagement in Deutschland sind schwer abzuschätzen. Einerseits hängt ihr Einfluss maßgeblich von ihrer zukünftigen Verbreitung ab, andererseits bestehen noch offene Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbilanz. Eine plausible These lautet, dass geschlossene Produktionssysteme prinzipiell die Resilienz der Landwirtschaft deutlich steigern können, indem sie Abhängigkeiten von externen Ressourcen (vor allem Wasser) und Umwelteinflüssen verringern.
Für das Wassermanagement bieten geschlossene Produktionssysteme zudem auch unabhängig von Klimabedingungen den Vorteil, dass aufgrund der zirkulären Verfahren insgesamt weniger Wasser benötigt wird und Verluste durch Versickern oder Verdunstung vermieden werden [1][2]. Vertical Farming erfordert einen um ein Vielfaches geringeren Wassereinsatz als die herkömmliche Landwirtschaft, teilweise um bis zu 95 % weniger [1]. Dies gilt sowohl verglichen mit Freilandanbau als auch mit Anbau in Gewächshäusern [1].
Im Fall von kultiviertem Fleisch ist aufgrund des frühen Adoptionsstadiums eine Abschätzung der Umweltwirkungen noch relevanter, gleichzeitig mit größerer Unsicherheit behaftet. Im Vergleich zu Rindfleisch besteht das Potenzial für geringeren Wasserverbrauch, im Vergleich zu anderen Fleischarten ist der Verbrauch voraussichtlich ähnlich [5][18][4]. Rund die Hälfte des Wassers wird für die Herstellung selbst benötigt, die andere Hälfte für die Lieferkette sowie für die Energieproduktion und die Errichtung und den Unterhalt der Infrastruktur [18][19].
Der Wasserfußabdruck der Präzisionsfermentation von Milchproteinen bewegt sich insgesamt auf einem ähnlichen Niveau wie bei der herkömmlichen Milchproduktion. Es bestehen jedoch Potenziale zur Reduktion des Wasserverbrauchs beispielsweise durch die Nutzung alternativer Nährmedien [20]. Die Berücksichtigung vorgelagerter Lieferkettenstufen – etwa der Chemikalienherstellung für Nährmedien – verschlechtert die Bilanz hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wasserqualität [18][19].
Durch Vertical Farming könnte die Eutrophierung von Gewässern durch Einträge aus der Landwirtschaft um 70-90 % reduziert werden [1]. Auch die Produktion von kultiviertem Fleisch soll die Eutrophierung von Frischwasser verringern [18][19][4].
Durch die geschlossenen Produktionsbedingungen sinkt zudem das Risiko von Schädlingsbefall und Krankheiten [5][1]. Die Verbreitung von Krankheitserregern, die in der Tierhaltung vorkommen (z.B. Schweinegrippe) oder über Lebensmittel tierischer Herkunft übertragen werden (z.B. Salmonellen), können unter den sterilen Produktionsbedingungen von zellulären Lebensmitteln ausgeschlossen werden [5][4]. Zudem sind die Produkte, beispielsweise pflanzliche Alternativen zu Milch von Tieren, frei von Antibiotika [14].
Ein weiteres Potenzial geschlossener Produktionssysteme ist der reduzierte Flächenbedarf, durch den sich bisherige landwirtschaftliche Böden bei entsprechender Umnutzung regenerieren könnten [4]. Im Vertical Farming kann auf weniger Fläche und mit kürzeren Erntezyklen angebaut werden. Freigewordene Flächen könnten für Renaturierung und Wasserretention genutzt werden. So können die Systeme auch indirekt auf den Wasserhaushalt einwirken. Beim Vergleich der Landnutzung von geschlossenen Systemen mit herkömmlicher Landwirtschaft muss allerdings die Fläche berücksichtigt werden, die für Energieerzeugung benötigt wird. Je nach Energiequelle kann dies einen erheblichen Flächenbedarf bedeuten. Das kann dazu führen, dass der Vergleich der Flächeneffizienz weniger vorteilhaft ausfällt [1].
Kurzfristig sind die Verbreitungspotenziale von Vertical Farming in Deutschland vor allem durch die hohen Investitions- und Betriebskosten eingeschränkt. Für gut geeignete Pflanzen wie Salate und Kräuter könnte Vertical Farming schon in naher Zukunft stärker genutzt werden. Auch Pflanzen, die besonders hohe Verkaufspreise erzielen und von den kontrollierten Bedingungen des Vertical Farmings besonders profitieren – beispielsweise solche, die für pharmazeutische Anwendungen benötigt werden [2] – könnten zeitnah in vertikalen Farmen kultiviert werden, da sich hier trotz der hohen Kosten eine gute Rentabilität erzielen lässt.
Mittelfristig besteht die Aussicht, dass technologische Innovationen die Energieeffizienz im Vertical Farming deutlich steigern und dadurch die Betriebskosten erheblich senken können. Mit der weiteren Verbreitung erneuerbarer Energien wird zudem die direkte Kopplung an Energiequellen, beispielsweise an Windparks, erleichtert. Damit ist die Möglichkeit gemeint, die Produktion effizient an erneuerbare Energiequellen anzuschließen, um Stromkosten zu reduzieren und den Eigenbedarf nachhaltig zu decken. Wenn auch die Investitionskosten verringert werden können, beispielsweise durch die Umnutzung von Industriegebäuden, könnte Vertical Farming auch für Kulturen wie Gemüse und Beeren attraktiv werden. Dies hängt jedoch auch von der Nachfrage ab, die unter anderem von dem Erfolg der Vermarktung als lokale und gesunde Produkte abhängt. Hier könnte ein Label wichtig sein [8]. Auch die Preise von Konkurrenzprodukten sind maßgeblich für die Entwicklung der Rentabilität.
Die Verbreitungspotenziale von kultiviertem Fleisch sind kurzfristig eingeschränkt, mittel- bis langfristig aber erheblich. Wie bereits dargestellt, sind die Produktionskosten für kultiviertes Fleisch derzeit hoch, und Abschätzungen der Potenziale zur Kostensenkung unterscheiden sich stark, abhängig von der Fleischart. Bevor optimierte Herstellungsverfahren mit höherer Ressourcen- und Energieeffizienz verfügbar sind, ist eine Skalierung unwahrscheinlich [5][4][15]. Im Fall von tierfreien Milchproteinen durch Präzisionsfermentation scheinen Produktionskosten, die einen konkurrenzfähigen Marktpreis möglich machen, absehbarer und werden teilweise schon für das laufende Jahr 2025 prognostiziert [12].
- van Gerrewey, T. et al.(2022): Vertical Farming: The Only Way Is Up? In: Agronomy 12(1), S. 2, DOI: 10.3390/agronomy12010002
- Wittmann, S. et al. (2020): Indoor Vertical Farming: konsequente Weiterentwicklung des geschützten Anbaus. In: Frerichs, Ludger (Hrsg.): Jahrbuch Agrartechnik 2020. Braunschweig: Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge, 2021. S. 1-15, DOI: 10.24355/dbbs.084-202012111306-0
- Erekath, S. et al.(2024): Food for future: Exploring cutting-edge technology and practices in vertical farm. In: Sustainable Cities and Society 106, S. 105357, DOI: 10.1016/j.scs.2024.105357
- Treich, N. (2021): Cultured Meat: Promises and Challenges. In: Environmental & Resource Economics 79(1), S. 33–61
- TAB (2023): Potenziale und Herausforderungen einer zellkulturbasierten Fleischproduktion. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (Autor/innen: Jetzke, T.; Dassel, K.), Themenkurzprofil Nr. 62, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000156303
- Boukid, F. et al. (2023): Fermentation for Designing Innovative Plant-Based Meat and Dairy Alternatives. In: Foods (Basel, Switzerland) 12(5), 1005, DOI: 10.3390/foods12051005
- Asseng, S. et al. (2020): Wheat yield potential in controlled-environment vertical farms. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117(32), S. 19131–19135, DOI: 10.1073/pnas.2002655117
- ISW (2020): HypoWave: Einsatz hydroponischer Systeme zur ressourceneffizienten landwirtschaftlichen Wasserwiederverwendung Gemeinsamer Schlussbericht des Verbundvorhabens. Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Braunschweig
- BMBF (2024): Agrarsysteme der Zukunft. Smart und nachhaltig Lebensmittel produzieren. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
- idw (Hg.) (2024): Indoor Vertical Farming: KI-gesteuerte Produktion von Beerenfrüchten durch neue Sensorsysteme. Informationsdienst Wissenschaft, idw-online.de (11.04.2025)
- Preiss, M. et al. (2022): Trends Shaping Western European Agrifood Systems of the Future. In: Sustainability 14(21), S. 13976, DOI: 10.3390/su142113976
- Augustin, M. et al. (2024): Innovation in precision fermentation for food ingredients. In: Critical reviews in food science and nutrition 64(18), S. 6218–6238, DOI: 10.1080/10408398.2023.2166014
- Broad, G. et al. (2022): Framing the futures of animal-free dairy: Using focus groups to explore early-adopter perceptions of the precision fermentation process. In: Frontiers in nutrition 9, S. 997632, DOI: 10.3389/fnut.2022.997632
- Szczepanski, L. et al. (2023): Pflanzliche Milchalternativen: Produktion, Nachhaltigkeit und Akzeptanz. In: Biologie in Unserer Zeit 53(4), S. 350-360, DOI: 10.11576/biuz-6750
- Vergeer, R. et al. (2021): TEA of cultivated meat. Future projections of different scenarios – corrigendum. CE Delft, Delft (Nov 2021), https://cedelft.eu
- Weinrich et al. (2020): Consumer acceptance of cultured meat in Germany. In: Meat science, 162, 107924, 10.1016/j.meatsci.2019.107924
- Ronchetti et al. (2024). The regulatory Landscape in the EU for Dairy products derived from precision fermentation. SpringerBriefs in Law, DOI: 10.1007/978-3-031-49692-9
- Sinke, P. et al. (2023b): Ex-ante life cycle assessment of commercial-scale cultivated meat production in 2030. In: Int J Life Cycle Assess 28(3), S. 234–254, DOI: 10.1007/s11367-022-02128-8
- Sinke, P. et al. (2023a): Correction: Ex-ante life cycle assessment of commercial-scale cultivated meat production in 2030. In: Int J Life Cycle Assess 28(9), S. 1225–1228, DOI: 10.1007/s11367-023-02183-9
- Behm, K. et al. (2022): Comparison of carbon footprint and water scarcity footprint of milk protein produced by cellular agriculture and the dairy industry. In: Int J Life Cycle Assess 27(8), S. 1017–1034, DOI: 10.1007/s11367-012-0386-y
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Resilienz-Dossier Wassermanagement in der Landwirtschaft (Autor/innen: Behrendt, S.; Bledow, N.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kollosche, I.; Uhl, A.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/wassermanagement-in-der-landwirtschaft/
- van Gerrewey, T. et al.(2022): Vertical Farming: The Only Way Is Up? In: Agronomy 12(1), S. 2, DOI: 10.3390/agronomy12010002
- Wittmann, S. et al. (2020): Indoor Vertical Farming: konsequente Weiterentwicklung des geschützten Anbaus. In: Frerichs, Ludger (Hrsg.): Jahrbuch Agrartechnik 2020. Braunschweig: Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge, 2021. S. 1-15, DOI: 10.24355/dbbs.084-202012111306-0
- Erekath, S. et al.(2024): Food for future: Exploring cutting-edge technology and practices in vertical farm. In: Sustainable Cities and Society 106, S. 105357, DOI: 10.1016/j.scs.2024.105357
- Treich, N. (2021): Cultured Meat: Promises and Challenges. In: Environmental & Resource Economics 79(1), S. 33–61
- TAB (2023): Potenziale und Herausforderungen einer zellkulturbasierten Fleischproduktion. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (Autor/innen: Jetzke, T.; Dassel, K.), Themenkurzprofil Nr. 62, Berlin, DOI: 10.5445/IR/1000156303
- Boukid, F. et al. (2023): Fermentation for Designing Innovative Plant-Based Meat and Dairy Alternatives. In: Foods (Basel, Switzerland) 12(5), 1005, DOI: 10.3390/foods12051005
- Asseng, S. et al. (2020): Wheat yield potential in controlled-environment vertical farms. In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 117(32), S. 19131–19135, DOI: 10.1073/pnas.2002655117
- ISW (2020): HypoWave: Einsatz hydroponischer Systeme zur ressourceneffizienten landwirtschaftlichen Wasserwiederverwendung Gemeinsamer Schlussbericht des Verbundvorhabens. Institut für Siedlungswasserwirtschaft, Braunschweig
- BMBF (2024): Agrarsysteme der Zukunft. Smart und nachhaltig Lebensmittel produzieren. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
- idw (Hg.) (2024): Indoor Vertical Farming: KI-gesteuerte Produktion von Beerenfrüchten durch neue Sensorsysteme. Informationsdienst Wissenschaft, idw-online.de (11.04.2025)
- Preiss, M. et al. (2022): Trends Shaping Western European Agrifood Systems of the Future. In: Sustainability 14(21), S. 13976, DOI: 10.3390/su142113976
- Augustin, M. et al. (2024): Innovation in precision fermentation for food ingredients. In: Critical reviews in food science and nutrition 64(18), S. 6218–6238, DOI: 10.1080/10408398.2023.2166014
- Broad, G. et al. (2022): Framing the futures of animal-free dairy: Using focus groups to explore early-adopter perceptions of the precision fermentation process. In: Frontiers in nutrition 9, S. 997632, DOI: 10.3389/fnut.2022.997632
- Szczepanski, L. et al. (2023): Pflanzliche Milchalternativen: Produktion, Nachhaltigkeit und Akzeptanz. In: Biologie in Unserer Zeit 53(4), S. 350-360, DOI: 10.11576/biuz-6750
- Vergeer, R. et al. (2021): TEA of cultivated meat. Future projections of different scenarios - corrigendum. CE Delft, Delft (Nov 2021), https://cedelft.eu
- Weinrich et al. (2020): Consumer acceptance of cultured meat in Germany. In: Meat science, 162, 107924, 10.1016/j.meatsci.2019.107924
- Ronchetti et al. (2024). The regulatory Landscape in the EU for Dairy products derived from precision fermentation. SpringerBriefs in Law, DOI: 10.1007/978-3-031-49692-9
- Sinke, P. et al. (2023b): Ex-ante life cycle assessment of commercial-scale cultivated meat production in 2030. In: Int J Life Cycle Assess 28(3), S. 234–254, DOI: 10.1007/s11367-022-02128-8
- Sinke, P. et al. (2023a): Correction: Ex-ante life cycle assessment of commercial-scale cultivated meat production in 2030. In: Int J Life Cycle Assess 28(9), S. 1225–1228, DOI: 10.1007/s11367-023-02183-9
- Behm, K. et al. (2022): Comparison of carbon footprint and water scarcity footprint of milk protein produced by cellular agriculture and the dairy industry. In: Int J Life Cycle Assess 27(8), S. 1017–1034, DOI: 10.1007/s11367-012-0386-y