Innovative Bewässerungssysteme
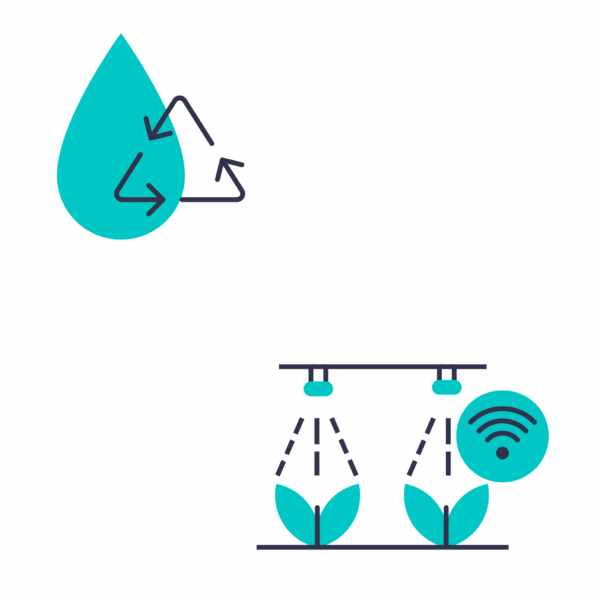
Innovative Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft umfassen Verfahren, die eine gezielte, effiziente und nachhaltige Wasserversorgung für Pflanzen bei minimalem Verbrauch ermöglichen. Sie kombinieren Tropf- und Mikrobewässerung mit Sensorik und datenbasierten Anwendungen, unterstützt durch künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge. Durch präzise Steuerung gelangt Wasser direkt zu den Pflanzenwurzeln, wodurch Verdunstungsverluste sinken und die Wasseraufnahme verbessert wird. Echtzeitdaten erlauben es, den Wasserbedarf dynamisch an Umweltbedingungen anzupassen und so übermäßige Bewässerung zu vermeiden, insbesondere in Hitze- und Trockenperioden. Neben herkömmlichen Wasserquellen setzen innovative Bewässerungssysteme auf alternative Einspeisekonzepte, wie die Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser, auf Regenwasserspeicherung und eine salzarme Wasseraufbereitung. So werden Wasserressourcen geschont, die Wasserversorgung in niederschlagsarmen Gebieten gesichert und die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegenüber Wetterextremen und den langfristigen Folgen des Klimawandels.
Im Folgenden werden der Status quo sowie die Potenziale und Entwicklungsdynamiken in diesem strategischen Themenfeld beschrieben.
Status quo
Im weltweiten Vergleich werden in Deutschland landwirtschaftliche Flächen nur in geringem Maße bewässert. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland etwa 3,3 % der landwirtschaftlich genutzten Freilandfläche bewässert. Das entspricht rund 554.000 Hektar [1][2]. Sowohl die bewässerte Fläche als auch die Anzahl der Betriebe mit Bewässerungstechnik sind ungleichmäßig über die Bundesländer verteilt. Den weitaus größten Anteil aller deutschen Bundesländer hat Niedersachsen mit 47 % der gesamten landwirtschaftlich bewässerten Fläche in Deutschland [3]. Hauptursachen sind die sandigen Böden mit geringer Wasserhaltekapazität, die besondere Anfälligkeit für Dürreperioden sowie der umfangreiche Anbau empfindlicher Kulturen wie Kartoffeln und Gemüse.
Vorteile für landwirtschaftliche Betriebe, die sich durch den Einsatz von Bewässerungssystemen ergeben können, betreffen vier Bereiche: (1) die Ertragssicherung, d.h. die Sicherung der Ernte; (2) die Qualitätssicherung, etwa durch die Vermeidung von Dürreschäden, welche wiederum Auswirkungen auf den erzielbaren Preis der Ware hat; (3) die Möglichkeit, hinsichtlich des Wasserbedarfs anspruchsvollere Kulturen anzubauen; (4) die besonders intensive, mehrfache Nutzung derselben Fläche für unterschiedliche Kulturen [4].
Die eingesetzten Bewässerungstechniken unterscheiden sich zum Teil deutlich hinsichtlich ihres Effizienzgrades, der aufzuwendenden Investitionskosten sowie möglicher Einsatzgebiete. Grundsätzlich wird technisch zwischen Oberflächenbewässerung und Druckbewässerung unterschieden. Während bei der Oberflächenbewässerung das Wasser an der Oberfläche angestaut wird, bevor es mithilfe von Kanälen oder einer anderen Vorrichtung über das Feld verteilt wird, wird bei der Druckbewässerung das Wasser über ein Rohrsystem zum Feld gepumpt und dort per Restdruck weiterverteilt. In Deutschland werden aktuell fast ausschließlich unterschiedliche Verfahren der Druckbewässerung genutzt [3]. Zu diesen zählen etwa die Bewässerung mittels Beregnungsmaschinen, die oberirdische Tropfbewässerung und die unterirdische (Tropf-)Bewässerung. Welche Methode von Landwirtschaftsbetrieben eingesetzt wird, hängt letztlich von einer Kombination unterschiedlicher Faktoren ab. Dazu zählen neben den Investitionskosten und der Umsetzbarkeit auch natürliche Einflussgrößen wie der Bodentyp, die Wasserverfügbarkeit oder das Gefälle. Auch die Art der angebauten Pflanzenkulturen spielt eine Rolle.
Die Oberflächenbewässerung zählt zu den ältesten Bewässerungstechniken. Außerhalb Deutschlands spielen viele Arten der Oberflächenbewässerung auch heute noch eine wichtige Rolle, da sie relativ einfach, mit geringem Kostenaufwand und ohne aufwendige technische Vorrichtungen implementiert werden können. Grundsätzlich besteht das Prinzip der Oberflächenbewässerung in einer natürlichen Bewegung des Wassers über das Feld, wobei die Art der angewendeten Bewässerung unter anderem vom Neigungswinkel und Relief der zu bewirtschaftenden Fläche abhängt. Dazu zählen unterschiedliche Stauverfahren, wie etwa der Beckenstau, Flächenstau oder Furchenstau, bei denen bestimmte Bereiche des Feldes zeitweise unter Wasser gesetzt werden, sowie Verfahren der Berieselung, wie etwa die Streifenberieselung oder die Furchenberieselung, bei denen Wasser durch Äcker und geneigte Flächen hindurchfließt. Die Oberflächenbewässerung eignet sich nicht für alle Böden bzw. Pflanzenkulturen und kann zu starker Bodenerosion führen. Ein weiteres Problem sind der sehr hohe Wassereinsatz und eine damit zusammenhängende geringe Effizienz aufgrund von hohen Verdunstungs- und Versickerungsraten bei nahezu allen Arten dieser Bewässerungstechnik. In Deutschland hat die Oberflächenbewässerung daher für den landwirtschaftlichen Bereich derzeit keine Bedeutung mehr [3]. Ein zukünftiger Einsatz wäre nur unter Extrembedingungen wie dramatisch steigende Energiekosten bzw. weitgehende Energieknappheit bei gleichzeitig hohem Wasserdargebot denkbar.
Im Gegensatz zur Oberflächenbewässerung kommt bei der Druckbewässerung technischer Aufwand zum Einsatz, um das Wasser aktiv über das Feld zu verteilen. Ein typisches Verfahren ist die Beregnung, bei der Wasser unter Druck in Form von Regen- und Sprühbewässerung großflächig ausgebracht wird. Unter dem Begriff „Beregnung“ werden verschiedene Techniken zusammengefasst, die sich hinsichtlich ihrer technischen Ausstattung und Mobilität unterscheiden. Dazu zählen mobile Beregnungsmaschinen mit Großflächenregner, mobile Beregnungssysteme mit Düsenwagen, stationäre Großflächenbewässerungsanlagen und fest installierte Sprinkleranlagen.
Zu den am weitesten verbreiteten Beregnungstechniken in Deutschland zählt die mobile Beregnung mittels Großflächenregnern. Gründe für den häufigen Einsatz dieser Technik, mit der bis zu acht Hektar Fläche bewässert werden können, sind eine sehr hohe Flexibilität bei der Flächenbewirtschaftung bei relativ niedrigen Investitionskosten und die Möglichkeit, Fruchtfolgen mit bewässerten und nicht bewässerten Kulturen anzubauen. Allerdings fallen hohe Energiekosten für den laufenden Betrieb an, zudem können ungünstige Windverhältnisse die Verteilung des Wassers negativ beeinflussen [1][3]. Insbesondere wegen der weiten Verbreitung dieser Technologie sowie wegen der vergleichsweise niedrigen Investitionskosten werden mobile Beregnungsmaschinen in Deutschland vermutlich auch in absehbarer Zukunft eine zentrale Rolle bei der Bewässerung in der Landwirtschaft spielen. Die Maschinen werden zunehmend mit webbasierten Dokumentations- und Überwachungssystemen ausgestattet, um Arbeitsabläufe besser planen und Störungen schnell beheben zu können. Die Regner sind mit GPS-Sender und Drucksensoren ausgestattet, die entsprechende Daten permanent an Webserver senden und somit kann unmittelbar auf Störungen reagiert werden, was den Aufwand für Kontrollfahrten reduziert. Eine Kopplung mit Pumpsteuerungen ermöglicht einen Start von Elektro- oder auch Dieselpumpaggregaten auch per Smartphone [5].
Eine weitere auch in Deutschland eingesetzte Variante der Beregnungssysteme ist die mobile Beregnungsmaschine mit einem Düsenwagen. Im Gegensatz zu Großflächenregnern, die nach dem Prinzip des klassischen Rasensprengers funktioniert, wird bei diesen Wagen Wasser durch Schläuche gepumpt und strömt dann durch Düsen sehr gleichmäßig und bodennah auf die Pflanzen. Ihre Vorteile bestehen vor allem in einer wesentlich besseren Wasserverteilung gegenüber Großflächenregnern bei Wind, einer generell höheren Präzision bei der Wasserverteilung und einem geringeren Wasserdruck an den Düsen, was eine Energieeinsparung von etwa 20 % bewirken kann. Allerdings wird diese Art der Beregnung eher in kleineren Betrieben und bei neuen Anbauversuchen eingesetzt, da die Investitionskosten für einen breiten Einsatz auf großen Flächen relativ hoch sind.
Zu den nicht mobilen, sondern stationär installierten Großflächenbewässerungstechniken gehören Kreis- und Linearberegnungsmaschinen, die für große Flächen ab 25 Hektar eingesetzt werden. Ihre Tragwerke sind mit anhängenden Niederdruckdüsen dicht bestückt, was nur geringe Wasserwurfweiten an den Einzeldüsen erfordert und einen besonders energieeffizienten Betrieb dieser Anlagen mit geringem Wasserdruck bei gleichzeitig hoher Verteilgenauigkeit ermöglicht. Der Einspareffekt an Energie liegt im Vergleich zur mobilen Beregnungsmaschinen bei mindestens 50 %. Eine deutliche Ersparnis an Arbeitszeit bietet einen weiteren Vorteil zu allen anderen aktuell eingesetzten Bewässerungstechniken. Allerdings muss unter anderem wegen des Investitionsaufwandes eine gewisse Flächenmindestgröße gegeben sein.
Schließlich zählen auch noch Sprinkleranlagen zu den Bewässerungssystemen mittels Beregnung. Sie bestehen meist aus mehreren Schläuchen, die in einem Abstand von zehn bis zwölf Metern im Feld verlegt werden. Sprinkler werden im landwirtschaftlichen Bereich allerdings nur auf kleinen Flächen oder für Kulturen eingesetzt, die eine hohe Wertschöpfung generieren, da sowohl die Anschaffungskosten als auch der Arbeitsaufwand beim Aufbau der Anlagen relativ hoch sind [1][5].
Eine besonders effiziente Bewässerungstechnik ist die Tropfbewässerung bzw. lokale Beregnung. Dabei werden Schläuche oder Rohre eingesetzt, die das Wasser direkt zu den Wurzeln der Pflanzenkulturen befördern. Diese Technik hat einige Vorteile gegenüber anderen Techniken. Dazu zählen die präzise Wasserverteilung, eine Reduzierung des Wasserdrucks und somit der Energiekosten sowie die Einsparung von Wasser aufgrund geringer Verdunstung. Außerdem eignet sich die Tropfbewässerung besonders gut, um den Pflanzen über die Tropfschläuche Dünger zuzuführen (Fertigation). In Deutschland wird die Tropfbewässerung in der Landwirtschaft bisher vor allem bei Pflanzen eingesetzt, die besonders hohe Erträge versprechen, wie unterschiedliche Strauchobstsorten, Spargel, Zucchini etc. Wegen der relativ hohen Verfahrenskosten ist diese Technik für den klassischen Ackerbau aktuell wenig geeignet und bisher noch selten anzutreffen [6].
Eine relativ neue und bisher in Deutschland im Vergleich noch eher selten angewendete Bewässerungstechnik ist die unterirdische Bewässerung. Dabei wird über Rohrleitungen das Wasser direkt zu den Wurzeln der Pflanzen geleitet, was eine besonders effiziente und präzise Bewässerung bewirkt und kaum Wasserverlust durch Verdunstung mit sich bringt. Die Rohre werden in einer Tiefe von ca. 40 cm und in einem Abstand von einem halben bis einen Meter unterirdisch verlegt. Je höher die Lebensdauer einer solchen Bewässerungsanlage ist (aktuell in der Regel ca. zehn Jahre), desto eher lohnen sich die hohen Investitions- und Betriebskosten, die durch das Verlegen und das Wiederentnehmen der Rohre anfallen [1].
Ein Bewässerungssystem ist dann vorteilhaft, wenn es Wasser effizient (also präzise) verteilt, Bodenerosion minimiert, Ernteerträge fördert, mit möglichst wenig Energie pro gefördertem Liter Wasser auskommt und wenn es hinsichtlich des Arbeitszeitbedarfs günstige Werte liefert – kurz: wenn das System grundsätzlich nachhaltig und langfristig kosteneffizient arbeitet [1][3][5]. Der Faktor der Effizienz – oder anders ausgedrückt: Die Möglichkeit, mit relativ wenig Wasser-, Energie- und Kostenaufwand möglichst hohe Erträge zu erzielen, entscheidet darüber, ob der Einsatz eines bestimmten Bewässerungssystems in der Landwirtschaft lohnenswert ist. Diese Bestimmungsfaktoren sind jedoch keineswegs statisch, sondern unterliegen ihrerseits eigenen Dynamiken, sind in ihrem Zusammenspiel komplex und jeweils mit eigenen Unsicherheiten behaftet. So setzen sich beispielsweise die Kosten aus unterschiedlichen Variablen zusammen – wie Investitions-, Material-, Arbeits- und Reparaturkosten –, die mit der Zeit starken Veränderungen unterliegen können. Auch die Entwicklung der Marktpreise bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse kann die Rentabilität des Einsatzes von Bewässerungssystemen bei einzelnen Kulturen stark beeinflussen. Darüber hinaus kann die für die Bewässerung benötigte Wassermenge durch betriebliche, technologische, produktionstechnische und agronomische Maßnahmen und ein gezieltes Monitoring positiv beeinflusst (minimiert) werden.
Ein entscheidender Faktor beim Einsatz von Bewässerungssystemen ist die Entwicklung der Kosten im Kontext der zukünftigen physischen und institutionellen Wasserverfügbarkeit sowie der erwarteten Wassernachfrage. Der Aufbau einer Bewässerungsinfrastruktur kann aus agronomischer Sicht sinnvoll sein, um Ertragseinbußen bei unzureichenden Niederschlägen zu vermeiden. Ob sich diese Investitionen jedoch auch ökonomisch rechnen, hängt stark von regionalen Rahmenbedingungen, Wasserpreisen, Energieaufwand und Fördermöglichkeiten ab und ist daher in vielen Fällen nur eingeschränkt abschätzbar bzw. mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Wenn zur Bewässerung Grundwasser oder Wasser aus Oberflächengewässern verwendet wird, dann spielen zudem der Wasserstand und evtl. Entnahmeerlaubnisse für den Faktor der Wasserverfügbarkeit eine wichtige Rolle, die ihrerseits von den Wassernutzungsinteressen anderer Akteure sowohl innerhalb als auch außerhalb der Landwirtschaft abhängen können. Prinzipiell kann die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser zu einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität, der Bodenqualität und der Wasserökologie sowie zur Absenkung des Grundwasserspiegels führen [7].
Bei sinkendem Wasserdargebot sowohl infolge von Trockenheitsereignissen als auch bei (zum Teil damit zusammenhängenden) zunehmenden Interessenkonflikten um die Nutzung der begrenzten Wasserressourcen steigt das Risiko der Kürzung oder Umverteilung von Entnahmeerlaubnissen. Das Risiko führt dann zu einer Beeinträchtigung der Rentabilität von Investitionen in die Bewässerungsinfrastruktur [3].
Ein Weg, den landwirtschaftliche Betriebe gehen können, um sowohl die Wasserverfügbarkeit abzusichern als auch Interessenskonflikte mit anderen Wassernutzern zu vermeiden, besteht in der Erschließung und Nutzung alternativer Bewässerungsquellen. Dazu zählt u.a. der Bau eigener Wasserspeicherbecken zum Auffangen und zur späteren landwirtschaftlichen Verwendung von Regenwasser. Allerdings stellt sich hier ebenfalls die Frage nach der Rentabilität aufgrund hoher Investitionskosten. Vor dem Hintergrund zunehmender Niederschlagsmengen während der Feuchtperioden und strengerer Regelungen bei den Entnahmeerlaubnissen kann sich eine solche Investition aber in Zukunft zunehmend als lohnenswert erweisen.
Eine weitere Möglichkeit ist die Wiederverwendung von Brauchwasser (Betriebs- oder Nutzwasser). Eine EU-Verordnung über Mindestanforderungen bei der Wasserwiederverwendung trat 2020 in Kraft [9] und gilt seit 2023 für alle Mitgliedstaaten, also auch für Deutschland [8]. Ziel ist es, die Wasserknappheit in Folge des Klimawandels durch Wasserwiederverwendung bei der landwirtschaftlichen Bewässerung zur verringern und den Mitgliedstaaten die Umsetzung mit einheitlichen Vorgaben zu erleichtern. Allerdings liegt die Entscheidung für die Umsetzung der Verordnung bei den einzelnen Mitgliedsstaaten. Was in einigen EU-Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland bereits seit einigen Jahren praktiziert wird, wird in anderen EU-Staaten wie Irland, Österreich oder Polen (noch) nicht erlaubt [9]. Hierzulande ist die Wasserwiederverwendung zwar grundsätzlich erlaubt, wird allerdings zum Teil immer noch kontrovers diskutiert. So wurde von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) bereits 2022 ein Bericht vorgelegt, der eine Anpassung der EU-Richtlinien für Deutschland empfiehlt. Die Empfehlungen lauten unter anderem, die Anforderungen an die Wasserqualität bei Nahrungsmittelpflanzen zu verschärfen, einen direkten Kontakt zwischen aufbereitetem Wasser und Nahrungsmitteln für den Rohverzehr zu vermeiden und eine regelmäßige Überwachung der Stoffeinträge zum Schutz von Böden, Grundwasser und Oberflächengewässern zu gewährleisten [10]. Zudem liegt ein aktueller Referentenentwurf zum Dritten Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes [11] vor.
Potenziale und Entwicklungsdynamiken
Es ist davon auszugehen, dass die Nutzung alternativer Bewässerungsquellen, vor allem die Nutzung von Regenwasser aus Speicherbecken wie auch die Wasserwiederverwendung, in Zukunft in Deutschland einen entscheidenden Beitrag zur landwirtschaftlichen Bewässerung leisten können. Begünstigende Faktoren sind eine Absenkung der Investitionskosten bzw. eine positive Entwicklung beim Kosten-Nutzen-Verhältnis für den Bau von eigenen Wasserspeicherbecken, die Umsetzung der oben genannten Empfehlungen zur Wasserwiederverwendung sowie Fördermaßnahmen zur Finanzierung und Implementierung entsprechender Vorhaben.
Was die Bewässerungssysteme selbst betrifft, so weisen aktuelle technologische Entwicklungen sowie eine engere Verknüpfung von Bewässerungssystemen mit digitalen Technologien auf ein deutliches Effizienzsteigerungspotenzial hin. Dies betrifft vor allem den Einsatz von Sensoren und KI zur besseren Überwachung des Zustands der Böden und der Kulturpflanzen (Smart Irrigation), Automatisierungsansätze zur besseren Steuerung der Bewässerung sowie eine Verbesserung und höhere Langlebigkeit eingesetzter Materialien. Insgesamt ist seit einigen Jahren eine Entwicklung ausgehend vom Prinzip des „Precision Farming“ hin zu einem umfassenden Konzept des „Digital Farming“ zu beobachten [12]. Viele Landwirtschaftsbetriebe setzten bereits heute digitale Lösungen ein, etwa digitale Zwillinge der zu bewirtschaftenden Felder, welche es erlauben, den Feuchtigkeitsbedarf kontinuierlich zu überwachen und die Bewässerung in Echtzeit dem Bedarf anzupassen. Andere Autor/innen beschreiben, wie Wasserhaushaltsmodelle in Kombination mit Sensorik und Wetterdaten dabei helfen können, den Wasserhaushalt ganzheitlich zu betrachten und das Wasser zielgenauer – und letztendlich sparsamer – zu verteilen [13]. Solche Modelle können darüber hinaus aber auch als Instrument zur Planung eingesetzt werden, etwa um unterschiedliche Bewässerungsstrategien zuerst am Modell digital zu testen, bevor sie real angewendet werden und unter Umständen Erträge gefährden. Eine Kombination aus Modellen und internetbasierten Systemen ermöglicht die Integration sowohl von Sensordaten als auch Satelliten- bzw. Wetterdaten, wodurch die Automatisierung von Bewässerungssystemen sowie deren Effizienz deutlich verbessert werden kann [13][7].
Die fortschreitende digitale Vernetzung und eine KI-gestützte Datenanalyse in der Landwirtschaft werden im Rahmen unterschiedlicher Forschungsvorhaben und Pilotprojekte seit einigen Jahren erforscht und getestet. Bereits 2017 wurden erfolgreiche Feldtests in Pakistan durchgeführt, bei denen durch den Einsatz von KI für Bewässerungssysteme Wassereinsparungen von bis zu 40 % erzielt wurden. Das System, entwickelt von einem Projektkonsortium aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), der in Karachi ansässigen NED University of Engineering & Technology sowie dem Research Center for Artificial Intelligence (RCAI), errechnet dabei über den Einsatz von Sonden den optimalen Wasserbedarf in Abhängigkeit von den Bedürfnissen der jeweiligen Pflanzenkulturen, der Bodensituation und den aktuellen lokalen Wetterbedingungen [14]. Ein weiteres Forschungs- und Entwicklungsprojekt, welches 2022 an der Technischen Universität Wien abgeschlossen wurde, hatte ebenfalls die Entwicklung und Erprobung eines Prototyps für ein neues und intelligentes Bewässerungssystem zum Ziel. Dabei wurde eine umfassende Evaluation von auf dem Markt bereits verfügbaren Bewässerungssystemen durchgeführt, um auf der Basis dieser Erkenntnisse ein optimiertes System zu entwickeln [15].
In Deutschland wird aktuell im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) des Bundeswirtschaftsministeriums ein neues Pflanzenüberwachungssystem entwickelt, bei dem spezielle, an den Blättern der Kulturpflanzen angebrachte Sonden eingesetzt werden, um die Bewässerung so passgenau und effizient wie möglich zu gestalten [16]. Dabei werden auf einem 20 ha großen Feld ca. sechs Sonden mit Hilfe von Magneten an den Blättern angebracht. Auf diese Weise wird der sogenannte Turgordruck der Pflanze – vergleichbar mit dem Blutdruck beim Menschen – gemessen. Die Differenz zwischen magnetischem Druck und Turgordruck gibt Aufschluss über den Wassergehalt und wird durch die Sonde per Mobilfunk in Echtzeit an einen Server übermittelt, von welchem der Landwirt die entsprechenden Daten abrufen kann. Mithilfe dieser Technologie wurden Wassereinsparungen von bis zu 40 % und gesteigerte Ernteerträge von über 30 % erzielt. Aktuell sind weltweit ca. 1.500 Sonden im Einsatz. In der zweiten Ausbaustufe gibt das System nicht nur Auskunft über den Wasserbedarf, sondern veranlasst auch die Bewässerung automatisiert und eigenständig über eine Verbindung zum Bewässerungssystem [16].
Auch abseits des Landwirtschaftssektors werden neue, internetbasierte Bewässerungssysteme erprobt. So wurde in Erlangen 2023 im Rahmen eines Pilotprojekts ein System aus Sensoren und KI entwickelt, welches Kommunen in Bayern dabei unterstützen soll, die Bäume im öffentlichen Raum effizienter und ressourcenschonender zu bewässern [17]. Ein anderes IoT-basiertes Bewässerungssystem zur vertikalen Begrünung von Gebäuden – als Beitrag zur Klimatisierung urbaner Räume und zur Milderung von Klimafolgen wie zunehmende Hitze und Trockenheit – wurde am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik entwickelt [18].
Die beschriebenen Entwicklungen im Bereich von Digitalisierung, Datenintegration und Vernetzung deuten darauf hin, dass vor allem in diesem Bereich besonders große Potenziale auf dem Weg hin zu einem hoch effizienten Bewässerungsmanagement bestehen. Daneben werden auch politische Steuerungsinstrumente eine zentrale Rolle spielen. Dazu zählen etwa die Einführung einer verpflichtenden Betriebsberatung und die Erstellung von Anpassungsplänen, die vermehrte Förderung von Forschungsprojekten zur Weiterentwicklung von Bewässerungssystemen, um Wassereffizienz, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit zu steigern, oder auch die Förderung der Erstellung von regionalen Beregnungskonzepten [19].
- BZL (2024): Wie viel landwirtschaftliche Fläche wird in Deutschland bewässert? Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. www.landwirtschaft.de (19.02.2025)
- Destatis (2024): Im Jahr 2022 wurden 554 000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Freilandfläche bewässert. Statistisches Bundesamt, (10.04.2024), www.destatis.de (05.07.2025)
- Ebers, N. et al. (2023): Potenzialabschätzung von technischen Wasserspeicheroptionen, Bewässerungsansätzen und ihrer Umsetzbarkeit. Thünen-Institut, Thünen Working Paper Nr. 277, Braunschweig, DOI: 10.22004/ag.econ.338987
- Sinabell, F. et al. (2021): Volkswirtschaftliche Aspekte der Klimaanpassung in der Landwirtschaft. Eine konzeptionelle Fallstudie zur Bewässerung in Österreich. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.), Wien
- Schimmelpfennig, S. et al.(2018): Bewässerung in der Landwirtschaft. Tagungsband zur Fachtagung am 11./12.09.2017 in Suderburg. Braunschweig
- de Witte, T. (2017): Wirtschaftlichkeit der Feldbewässerung. Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, www.praxis-agrar.de (19.02.2025)
- Jandl, R. et al. (Hg.) (2024): Kapitel 4. Anpassungsoptionen in der Landnutzung an den Klimawandel. APCC Special Report: Landnutzung und Klimawandel in Österreich, Berlin, Heidelberg
- UBA (2024b): EU-Verordnung zu Wasserwiederverwendung. Umwelbundesamt, 18.12.2024, www.umweltbundesamt.de (19.02.2025)
- EU (2024): WISE Freshwater – Freshwater Information System for Europe. Water Reuse. Europäische Union, water.europa.eu (19.02.2025)
- LAWA (2022): Endbericht der LAWA-Ad hoc AG/KG Water Reuse an die 163. LAWA-Vollversammlung. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, www.lawa.de (19.02.2025)
- BMUV (Hg.) (2024b): Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, www.bmuv.de (14.04.2025)
- Griepentrog, H. (2019): Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wichtige Zusammenhänge kurz erklärt. www.dlg.org (19.02.2025)
- Keilholz, P. et al. (2021): Digitalisierung und Automatisierung der landwirtschaftlichen Bewässerung in Deutschland. Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (Hg.), Jahrbuch Agrartechnik 2020, Braunschweig
- DFKI (2017): Künstliche Intelligenz für Bewässerungssysteme – Feldtests in Pakistan belegen Einsparung von 40%. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, www.dfki.de (19.02.2025)
- FFG (2022): I²B – Intelligentes, individuelles Bewässerungsystem. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, projekte.ffg.at (19.02.2025)
- BMWK (2024): Tropfen für Tropfen: Wasser sparen in der Landwirtschaft. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, www.bmwk.de (19.02.2025)
- STMD Bayern (2023): Intelligente Sensortechnologie hilft Kommunen bei effizienter und ressourcenschonender Bewässerung von Bäumen / Digitalministerin Gerlach besucht Projekt in Erlangen. Bayerisches Staatsministerium für Digitales, 09.10.2023, www.stmd.bayern.de (19.02.2025)
- Frauenhofer UMSICHT (2022): Vertikale Begrünung im urbanen Raum. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, www.umsicht.fraunhofer.de (05.04.2025)
- UBA (2020): Effiziente Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft. Umweltbundesamt, 02.11.2020. www.umweltbundesamt.de (19.02.2025)
Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Resilienz-Dossier Wassermanagement in der Landwirtschaft (Autor/innen: Behrendt, S.; Bledow, N.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kollosche, I.; Uhl, A.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/wassermanagement-in-der-landwirtschaft/
- BZL (2024): Wie viel landwirtschaftliche Fläche wird in Deutschland bewässert? Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. www.landwirtschaft.de (19.02.2025)
- Destatis (2024): Im Jahr 2022 wurden 554 000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Freilandfläche bewässert. Statistisches Bundesamt, (10.04.2024), www.destatis.de (05.07.2025)
- Ebers, N. et al. (2023): Potenzialabschätzung von technischen Wasserspeicheroptionen, Bewässerungsansätzen und ihrer Umsetzbarkeit. Thünen-Institut, Thünen Working Paper Nr. 277, Braunschweig, DOI: 10.22004/ag.econ.338987
- Sinabell, F. et al. (2021): Volkswirtschaftliche Aspekte der Klimaanpassung in der Landwirtschaft. Eine konzeptionelle Fallstudie zur Bewässerung in Österreich. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hg.), Wien
- Schimmelpfennig, S. et al.(2018): Bewässerung in der Landwirtschaft. Tagungsband zur Fachtagung am 11./12.09.2017 in Suderburg. Braunschweig
- de Witte, T. (2017): Wirtschaftlichkeit der Feldbewässerung. Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, www.praxis-agrar.de (19.02.2025)
- Jandl, R. et al. (Hg.) (2024): Kapitel 4. Anpassungsoptionen in der Landnutzung an den Klimawandel. APCC Special Report: Landnutzung und Klimawandel in Österreich, Berlin, Heidelberg
- UBA (2024b): EU-Verordnung zu Wasserwiederverwendung. Umwelbundesamt, 18.12.2024, www.umweltbundesamt.de (19.02.2025)
- EU (2024): WISE Freshwater - Freshwater Information System for Europe. Water Reuse. Europäische Union, water.europa.eu (19.02.2025)
- LAWA (2022): Endbericht der LAWA-Ad hoc AG/KG Water Reuse an die 163. LAWA-Vollversammlung. Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser, www.lawa.de (19.02.2025)
- BMUV (Hg.) (2024b): Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, www.bmuv.de (14.04.2025)
- Griepentrog, H. (2019): Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wichtige Zusammenhänge kurz erklärt. www.dlg.org (19.02.2025)
- Keilholz, P. et al. (2021): Digitalisierung und Automatisierung der landwirtschaftlichen Bewässerung in Deutschland. Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (Hg.), Jahrbuch Agrartechnik 2020, Braunschweig
- DFKI (2017): Künstliche Intelligenz für Bewässerungssysteme – Feldtests in Pakistan belegen Einsparung von 40%. Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, www.dfki.de (19.02.2025)
- FFG (2022): I²B - Intelligentes, individuelles Bewässerungsystem. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, projekte.ffg.at (19.02.2025)
- BMWK (2024): Tropfen für Tropfen: Wasser sparen in der Landwirtschaft. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, www.bmwk.de (19.02.2025)
- STMD Bayern (2023): Intelligente Sensortechnologie hilft Kommunen bei effizienter und ressourcenschonender Bewässerung von Bäumen / Digitalministerin Gerlach besucht Projekt in Erlangen. Bayerisches Staatsministerium für Digitales, 09.10.2023, www.stmd.bayern.de (19.02.2025)
- Frauenhofer UMSICHT (2022): Vertikale Begrünung im urbanen Raum. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, www.umsicht.fraunhofer.de (05.04.2025)
- UBA (2020): Effiziente Bewässerungssysteme in der Landwirtschaft. Umweltbundesamt, 02.11.2020. www.umweltbundesamt.de (19.02.2025)